Überraschung! Die Verwaltung ist anders als „die Wirtschaft“
Bei Hans Christian Andersen gibt es ein Märchen über ein armes missratenes Entenküken. Es ist viel hässlicher als seine Geschwister, sein Gang im Gras und am Flussstrand ist nur ein ungeschicktes Watscheln. Seine Eltern ermahnen es ständig, sich doch bitte schön ein Vorbild an den anderen Entlein zu nehmen und sich gefälligst ein bisschen anzustrengen. Doch so sehr es sich auch – es will ihm nicht glücken.
Der weitere Gang der Geschichte ist bekannt. Als die Entchen älter werden, werden die Unterschiede immer größer. Schließlich stellt sich heraus, dass das hässliche Entlein dem Drängen seiner Eltern gar nicht nachkommen konnte – es war einfach von einer anderen Art. Es war ein Schwan.
Seit Jahrzehnten wird der öffentlichen Verwaltung der Spiegel der „Wirtschaft“ vorgehalten. Das Neue Steuerungsmodell von Anfang der 1980er Jahre wandte sich insbesondere an die kommunale Ebene. Die sollte sich an der Privatwirtschaft ein Beispiel nehmen und quasi marktgemäß verhalten. Was wurde da nicht alles ausgesponnen – bis hin zur Bildung von Vergleichsringen zwischen Ämtern verschiedener Kommunen, um Pseudomärkte zu bilden und Konkurrenzverhalten zu simulieren. (Bitte kein Missverständnis: die Vergleichsringe der KGSt hatten oft eine positive Wirkung – dort wo sie keine Konkurrenz praktizierten.)
Von der Wirtschaft lernen? Nichts gegen den branchenübergreifenden Wissenstransfer. Aber er muss zur eigenen DNA passen. Soll aus dem Schwan eine Ente werden, wird es nicht funktionieren.
Erfahrungen aus den USA
In ihrem kürzlich erschienenen Buch „Practical Innovation in Governement“ /Anmerkung 1/ gehen Al G. Robinson und Dean M. Schroeder den Erfahrungen nach, die öffentliche Organisationen in den USA gemacht haben, wenn sie „Best practices aus der Wirtschaft“ auf ihr eigenes Projektmanagement übertragen wollten. Ich will hier gar keine Beispiele aufzählen: wir haben in Deutschland genügend Erfahrungen mit stockenden oder scheiternden Projekten. Was mir weitergeholfen hat bei der Buchlektüre, war, dass die Autoren einige Faktoren aufzählen, warum
- a. die Verwaltungs-DNA besonders ist, so dass die angelesenen oder von Beratern angeschleppten Wirtschafts-Methoden nicht funktionieren konnten;
- b. die Verwaltungen sich dessen nicht zu schämen brauchen. So wie man sich nicht schämen muss, wenn man ein Schwan ist und keine Ente.
Vier ARten von Unterschieden
Worin bestehen nun die Unterschiede zwischen einer Verwaltung und einer Privatunternehmung vergleichbarer Größe? Nehmen wir als Beispiel die fiktive Kreisverwaltung Oberbergen. Sie hat 1.300 Mitarbeiter:innen. Was unterscheidet sie von dem Maschinenbauunternehmen MaxiPak, das Verpackungsmaschinen produziert?
- Die Kreisverwaltung ist viel komplizierter als MaxiPak. Der Maschinenbauer zählt vier Kernprozesse auf: „Maschinen konstruieren“, „Maschinen produzieren“, „Maschinen montieren“, „Ersatzteile liefern“.
Dagegen erstellt die Kreisverwaltung laut eigenem Produktplan 175 Produkte, von Kfz-Zulassungen über Fischereischeine bis zu Bodengutachten. Auf sieben Mitarbeiter entfällt rein rechnerisch ein Produkt. Die Verwaltung umfasst vier Dezernate, 38 Abteilungen und sieben Stabsstellen auf fünf Hierarchieebenen. – MaxiPak hätte längst jede Innovationskraft verloren und Insolvenz angemeldet. - Das hat zur Folge, dass die Führungskräfte in der Verwaltung sich nicht in Prozessen auskennen. Robinson und Schroeder schreiben, dass sie keine Branche kennen, in der Vorgesetzte so wenig über Prozesse wissen wie die oberen Führungskräfte im Public Service. Klar, zum Beispiel der Baudezernent in Oberbergen hat Abteilungen mit über 40 ganz unterschiedlichen Prozessen unter sich. Bauordnung (Bauanträge bearbeiten), Hochbau (Gebäude erstellen und sanieren), Liegenschaften (Gebäude bewirtschaften und z.T. vermieten) und Tiefbau (Straßen und Kanäle bauen) haben nur ganz wenig miteinander zu tun.
Das, was diese Ämter gemeinsam haben, sind nicht Prozesse, sondern Objekte (Gebäude, Flurstücke). Darüber kommunizieren sie und das leuchtet dem Dezernenten auch ein. Deshalb kümmert er sich vielleicht um ein gutes GIS, aber nicht um eine fundierte, prozessorientierte Einführung der E-Akte. - Verwaltungen sind viel komplexer als private Körperschaften. Das Unternehmen MaxiPak ist eine AG, aber eigentlich noch ein Familienunternehmen. Vielleicht streiten sich ein paar Familienmitglieder wie die Piechs und Porsches um die Ausrichtung der Firma. Aber das war’s dann schon an Komplexität der Interessen.
Wie viele Stakeholder zerren hingegen am Landratsamt Oberbergen! Der Kreistag mit seinen Fraktionen – sagt die eine Fraktion Ja, äußert sich die andere schon aus Prinzip kritisch. Die oberen Gebietskörperschaften, die viele Angelegenheiten per Gesetz regeln und auch über konkrete Kontrollrechte verfügen. Die Vereinigungen der Zivilgesellschaft, die ihre Interessen über politischen Druck auf die Kreisverwaltung vorantreiben wollen. Schließlich sind die Kreisangelegenheiten viel stärker im Fokus der Medien als Einzelunternehmen. - Die Arbeitsweisen der öffentlichen Verwaltung sind in viel höherem Maße gesetzlich reglementiert. MaxiPak kann einen Kundenauftrag, Umfang und Qualität seiner Umsetzung frei verhandeln. Eine Verwaltung ist in der Bearbeitung von Bürgeranliegen gesetzlich gebunden.
Das führt zu einer starken Beachtung gesetzlicher Rahmenbedingungen im Verhältnis zur Rolle, die die Kundenorientierung spielt. Und sie haben zu einem Übergewicht von Verwaltungsjuristen in Führungspositionen geführt im Verhältnis zu Fachexperten, die Prozesse und Kundenanliegen besser kennen.
Robinson und Schroeder nennen ein Beispiel, in dem eine neue Führungskraft in einer Verwaltung die RIE-Methode einführen wollte. /Anmerkung 2/ Ein kleines innovatives Projekt, das in der Wirtschaft innert 5 Tagen umgesetzt wurde, benötigte in der Verwaltung – 18 Monate. Warum? Weil drei Juristen in der Projektgruppe aus unterschiedlichen Abteilungen alle möglichen juristischen Risiken durchdeklinierten und sich dafür Erlaubnisse „von oben“ abholten, bevor sie an den ersten Umsetzungsschritt dachten. - Führungskräfte in oberen Hierarchiestufen denken in großen Projekten statt in einer Vielzahl kleiner Verbesserungsschritte. Kaizen ist ein Fremdwort (ist es ja auch). „Die Digitalisierung wird unsere Prozesse effizienter machen.“ So wird gewartet, bis „die Digitalisierung“ da ist.

Und was heißt das praktisch?
Die aufgezählten Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung sind alles andere als neu. Neu ist, welche Relevanz die amerikanischen Autoren ihnen beimessen: nicht als leicht andere Färbung im Federkleid innerhalb der Entenschar, sondern als wesentliche Differenzen zwischen „Arten“.
Praktisch raten Robinson und Schroder zu einer „Graswurzelstrategie“ bei der Realisierung innovativer Projekte. Das heißt, Praktiker in der Verwaltung, die etwas verbessern wollen – sogenannte „Innovatoren“ und oft auf der unteren Führungsebene angesiedelt – sollten ihre Projekte so anlegen, dass sie „unter dem Radar“ durchtauchen. Also sich und ihren Sachgebieten Projektziele vornehmen, die sie im Wesentlichen alleine umsetzen können. Das heißt vor allem,
- ohne auf rechtliche Hürden zu stoßen, die die Beteiligung von Juristen erfordern und
- ohne Beteiligung der IT-Abteilung.
Dafür bieten die Autoren verschiedene Beispiele aus der (US-amerikanischen) Praxis, die schnell und effizient waren und große Auswirkungen hatten. Darüber vielleicht mal mehr an anderer Stelle.
Anmerkungen
/1/ Alan G. Robinson (Autor), Dean M. Schroeder: Practical Innovation in Government: How Front-Line Leaders Are Transforming Public-Sector Organizations. Berret-Koehler Publishers, Juli 2022




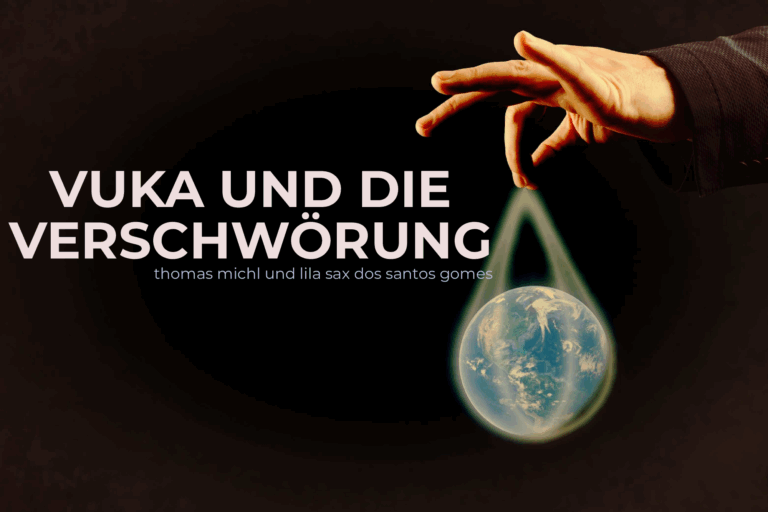
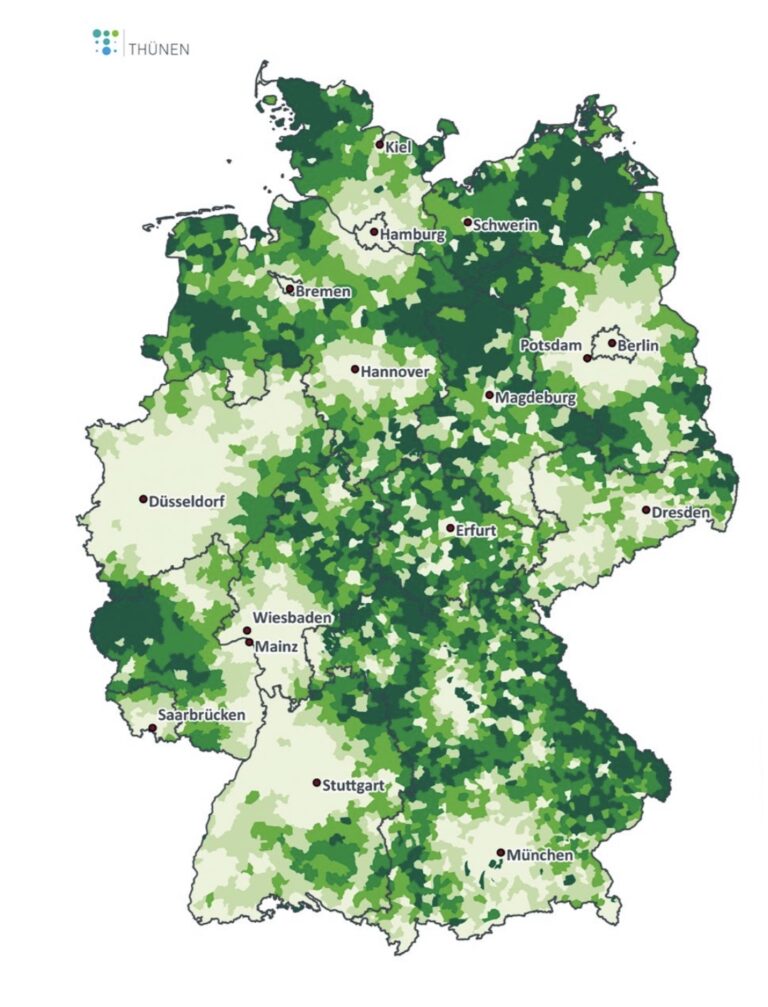
Danke für den anregenden Artikel. Ich beschäftige mich mit Wissensmanagement in der Verwaltung. Da trifft besonders der 1. und 2. Unterschied zu: Ad. 1: Es gibt sehr viele Spezialist:innen mit solitärem Wissen über Produkte / Leistungen, die nur sie betreuen. Wenn diese in Ruhestand gehen oder aus anderen Gründen wechseln, wissen kaum andere ausreichend Bescheid. Ein Strukturierter Wissenstransfer muss daher frühzeitig starten und auch teils Grundlagen vermitteln. Ad. 2. Führungskräfte haben eine zu hohe Distanz zu den Prozessen und Produkten. Da deren Anzahl, Komplexität und Veränderungsgeschwindigkeit aber zunimmt, wird es immer wichtiger, einen Austausch an Erfahrungswissen und strukturierte Reflexions- / Lernprozesse zu gestalten. Dazu passende Methoden zu finden, die in die Kultur passen (obwohl sie ungewohnt sind) und relativ einfach mit wenig Zeitaufwand machbar sind, ist nicht einfach.
Lieber Klemens,
vielen Dank für deine Anmerkungen. Vielleicht hast du Lust, mal über deine Erfahrungen hier auf unserem Blog zu berichten? Ich wäre an einem Austausch interessiert.
Herzlich, Wolf
Habe ich etwas übersehen..? Es gibt einen Verweis auf Anmerkung 2, aber unter den Anmerkungen gibt es keine Anmerkung 2.