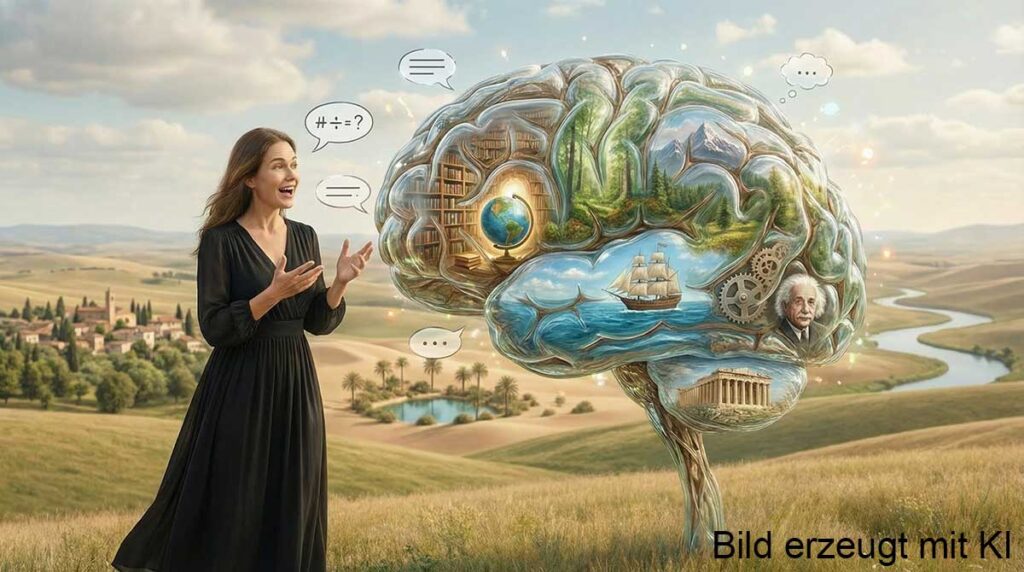Forum agile Verwaltung e.V.
Das Forum Agile Verwaltung „FAV“ ist ein Netzwerk aus der Praxis für die Praxis – für den Austausch und Coaching auf Gegenseitigkeit. Zu unseren Mitgliedern gehören Mitarbeitende und Führungskräfte aus der öffentlichen und kirchlichen Verwaltung in Deutschland und der Schweiz sowie Interessierte von außerhalb der Verwaltung mit Verwaltungserfahrung und auch Beratungsdienstleister.
Im Rahmen unserer Arbeit im Forum gilt der Grundsatz: Wir arbeiten ehrenamtlich und ohne kommerzielles Interesse. [weiterlesen]
Aktuelles
Die aktuellen Beiträge aus dem FAV-Blog
-
Ein gewagter Brückenschlag: Was hat Roland Barthes mit Changemanagement zu tun? Und welche Rolle spielt ChatGPT hierbei?
Was soll ich sagen? Dieser Artikel ist mir irgendwie entglitten. Eigentlich wollte ich nur über etwas schreiben, was mir seit…
-
Entscheidungshilfe KI-Einsatz: Das A3-Rahmenwerk
Wenn man der seit Monaten fast schon omnipräsenten Diskussion auf den üblichen Kanälen folgt, könnte man meinen, dass KI zur Wunderwaffe mutiert. Wie bei jedem Werkzeug sollte man sich seiner Stärken und Schwächen bewusst sein. Ebenso sollte man wissen, wann man es sinnvoll einsetzt und wann man es besser im Werkzeugkoffer lässt. Das A3-Rahmenwerk könnte ein Werkzeug sein, das hilft diese Entscheidung gut zu treffen.
-
Das Märchen von den sieben Sprints
Es war einmal in einem kleinen Königreich im Norden, wo die Bürger lange in Schlangen vor der Schreibstube standen. Manche warteten 47 Abende, bis ihre Genehmigung kam – und manchmal kam sie gar nicht …
-
Agile Arbeitswelten im Wandel: Zukunft oder Auslaufmodell? Ein Tagungsrückblick
Am 18. November 2025 versammelten sich im Atrium des geschichtsträchtigen O-Werks in Bochum zahlreiche Wissenschaftler:innen, Expert:innen, Praktiker:innen sowie Interessierte aus Industrie- und Sozialunternehmen, Gewerkschaften und Betriebsräten, um das Tagungsthema: „Agile Arbeitswelten im Wandel: Zukunft oder Auslaufmodell?“ zu diskutieren.
-
Mehr als nur die Spitze des Eisbergs: Was Agilität im Kern wirklich ausmacht
Kennen Sie das auch? Ihre Behörde oder Abteilung soll „agil“ werden. Es werden Scrum-Rituale eingeführt, Kanban-Boards aufgehängt und alle sprechen…
-
Nutzbare Werte – 7 Haltungen neu mal an die Arbeit schicken
Werte.Fast jede Organisation hat sie – sauber gelistet auf der Webseite, gerahmt, vielleicht sogar kalligraphiert oder laminiert. Mal ehrlich: Wie…
-
Vom Initiieren bis zum Weitertragen: Wie intersektorale Zusammenarbeit gelingt!
Von Dr. Verena Schmid, Prof. Dr. Monika Gonser Wie kann erreicht werden, dass die Sektoren Staat/Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft tatsächlich…
-
Host Leadership | Eine neue Metapher der Führung?
Vor wenigen Wochen bin ich im Rahmen eines Trainings auf ein Buch von Mark McKergow und Helen Bailey aus dem…
-
Agile Verwaltung als adaptive, kontinuierlich lernende Organisation
Eigentlich wollte ich mich an der ganzen „Agile ist tot“-Debatte nicht beteiligen. Daran haben sich schon so viel abgearbeitet, dass…