Zukunftsfähigkeit entsteht durch Tun – ein Aufruf zu mehr Mut in der Amtsstube
Ich mache mir derzeit wieder Gedanken darüber, wie wir die Zukunftsfähigkeit unserer (Kommunal-)Verwaltung(en) sichern können. Ich höre viel von quantitativer Überforderung durch immer mehr Aufgaben, von leeren Kassen, von wachsendem Druck durch Fachkräftemangel. Ich spüre eine große Überforderung beim Thema Digitalisierung, merke, wie schwer sich die Verwaltung noch tut, auf Veränderungen zu reagieren. Ich erlebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung, die – ich nenne es mal so – im Hamsterrad gefangen sind, ausschließlich reaktiv agieren und darunter sehr leiden.
Sie wirken hilflos und überfordert mit der Situation, die es ihnen nicht erlaubt, aktiv und vorausschauend zu arbeiten. Das ist nicht böse gemeint. Ganz im Gegenteil. Gerade auf kommunaler Ebene fallen immer wieder positive Beispiele auf, die unter den gegebenen Rahmenbedingungen versuchen, auch jenseits der bestehenden Denkstrukturen Lösungswege zu suchen und zu finden, dabei durchaus erfolgreich sind und damit eigentlich Vorbild sein könnten. Aber es sind und bleiben kleine, wenig beachtete Inseln. Die Realität in den Amtsstuben ist der – aus quantitativer Überforderung resultierende – Tunnelblick und ein Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene, der fernab der Lebensrealität – ohne wirkliche Einbindung der operativen Ebene – immer wieder gut gemeint die Situation verschlimmert. Etwas mehr Gemba – mehr an den Ort des Geschehens gehen – würde hier nicht schaden. Und ich höre viele sagen, so geht es nicht weiter – leider oft verbunden mit Forderungen an andere, verhaftet in problemorientiertem statt lösungsorientiertem Denken. Das ist meine gefühlte Wahrnehmung der Situation. Um es gleich vorweg zu sagen: Ich habe keine Blaupause. Die Situation ist mindestens kompliziert, wenn nicht sogar komplex. Aber das ist die normale Realität einer realen Welt. Es gibt kein Schwarz und Weiß, kein simpel und einfach. Auch wenn bestimmte Gruppen in unserem Land uns das weiß machen wollen und behaupten.
Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten. Digitalisierung? Technisch eigentlich keine Herausforderung. Es gibt Low- und No-Code-Lösungen, mit denen wir standardisierbare Prozesse (DGSVO-konform!) schnell und einfach unterstützen können und könnten und damit eine enorme Entlastung schaffen könnten. Stundenlange Warteschleifen in den Auskunftshotlines der Ämter sollten bei vielen Anfragen auch nicht mehr sein, denn gerade Routineauskünfte können von Chatbots übernommen werden. Auch das ist längst keine Raketenwissenschaft mehr. Die Technik ist nicht das Problem. Sondern die Fokussierung auf die Außenwirkung, statt im Hintergrund ordentlich aufzuräumen. Es braucht digitalisierbare Prozesse, Abläufe und digitalfähige Organisationsstrukturen. Viel zu oft wird von eAkte gesprochen und am Ende eine digitale Variante der Papierakte eingeführt, ohne auch nur ansatzweise die Strukturen und Prozesse im Hintergrund mit einzubeziehen, so bleiben wir weit hinter den Möglichkeiten zurück, Mitarbeiter:innen zu entlasten und Bürger:innen einen echten Mehrwert zu bieten. Wir brauchen nicht die x-te Bürger-App, wir brauchen Arbeitsstrukturen und Arbeitsweisen, die die Zusammenarbeit mit digitalen Elementen ermöglichen, ohne die Qualität der Arbeit in Frage zu stellen und gleichzeitig eine Erleichterung für alle Beteiligten darstellen (Kaizen lässt grüßen). Ein schlechter Prozess bleibt auch digital ein schlechter Prozess. Etwas mehr 5S im Kopf, etwas mehr von rechts nach links denken, Prozesse vom Ergebnis her organisieren, wirkt Wunder. Richtig eingesetzt schlummert hier ein enormes Potenzial, um die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten. Entlasten, damit sie sich um die Dinge kümmern können, die hochkompliziert und komplex sind. Dinge, die für die Bürger:innen einen Nutzen stiften können.
Das allein wird nicht reichen. Das dürfte klar sein. Wir haben noch viel mehr Möglichkeiten, von denen ich in meinem kleinen Beitrag hier nur einen Bruchteil ansprechen kann. Die genannten technischen Lösungen machen alle nur Sinn, wenn wir das vorhandene Wissen und Können nutzbar machen. Damit meine ich übrigens nicht nur das Wissen und Können in den Amtsstuben selbst. Sondern auch das Wissen und Können im Umfeld. Betroffene zu Beteiligten machen, das klingt abgedroschen. Aber es wird auch dort nicht wirklich gelebt, wo man es immer und immer wieder hört. Eine Bürgerbeteiligung mit Online-Format und Fragebogen ist in meinen Augen allenfalls ein erster Einstieg. Bleibt aber weit hinter den Möglichkeiten zurück. Und gerade wenn wir zu einer zukunftsfähigen Verwaltung kommen wollen, haben wir hier auch die Möglichkeit, Wissen und Können ins Boot zu holen, das extrem hilfreich sein kann. Wir müssen dieses Wissen und Können nach innen und nach außen aktivieren, wecken und einbinden. Das ist meine feste Überzeugung. Und ich bin überzeugt, dass wir auf diese Weise mehr Ideen, Impulse und Lösungen generieren können, als wir uns vorstellen können. Das beginnt im Kleinen und Internen mit der „Koalition der Willigen“, die innerhalb der Verwaltung versucht, den Tunnelblick aufzubrechen und gemeinsam in evolutionären Schritten das Innehalten, Reflektieren und Lernen im Sinne von Kaizen zu fördern. Wer mit offenen Augen und Ohren durch den Arbeitsalltag geht, sieht, hört und entdeckt viele – oft kleine – Stellschrauben, mit denen sich viel erreichen lässt. Man frage diejenigen, die täglich die Arbeit machen, und sie werden einem sagen, wo die Probleme liegen. Und weiter geht es mit der Einbindung der Zielgruppen als Impulsgeber und Alltagsexperten z.B. in Bürgerräten.
Letztlich braucht es den Mut, ausgetretene Pfade zu verlassen und außerhalb der gewohnten Strukturen zu denken. Das methodische und technische Rüstzeug ist längst vorhanden. Scrum, Kanban, Kaizen, Gemba … alles schon da und es funktioniert. Beispiele haben wir hier im Blog genug. Was fehlt, ist der Ausbruch aus den Denkmustern und der Mut, Strukturen in Frage zu stellen. Manchmal reichen kleinste Veränderungen, um Innovationspotenziale zu wecken und Lösungsfenster zu öffnen, die bisher nicht wahrgenommen wurden. Auch wenn das Beispiel des Herrenberger Start-Ups Bauhof längst kein Geheimtipp mehr ist – hier zeigt sich, dass eine kleine strukturelle Veränderung große Wirkung entfalten kann. Man muss es nur wollen und bereit sein, sich darauf einzulassen. Plötzlich wird vieles möglich. Und für alle, die befürchten, dass das Risiko viel zu hoch ist und die Gefahren von Veränderungen nicht abschätzbar sind – genau dafür wurden die agilen Ansätze geschaffen. Mit kleinen, inkrementellen Veränderungen an die bestmögliche Lösung herantasten. Das erfordert aber auch den Mut und die Bereitschaft, eingefahrene Denkpfade zu verlassen und sich zu öffnen. Jammern hilft nicht. Jammern ändert nichts. Nur durch Tun verändert sich etwas. Agilhausen ist nicht fiktiv, Agilhausen kann überall sein!


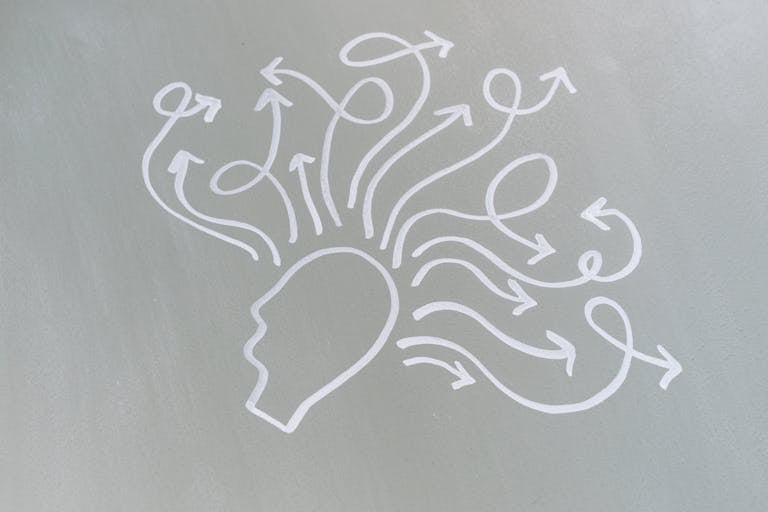

Schöne Zusammenfassung, auch wenn die Worte vielleicht nicht auf immer auf offene Ohren stoßen. Lässt sich doch wünschen das sich einige hieran den Mut finden, jetzt einfach „los zu laufen“