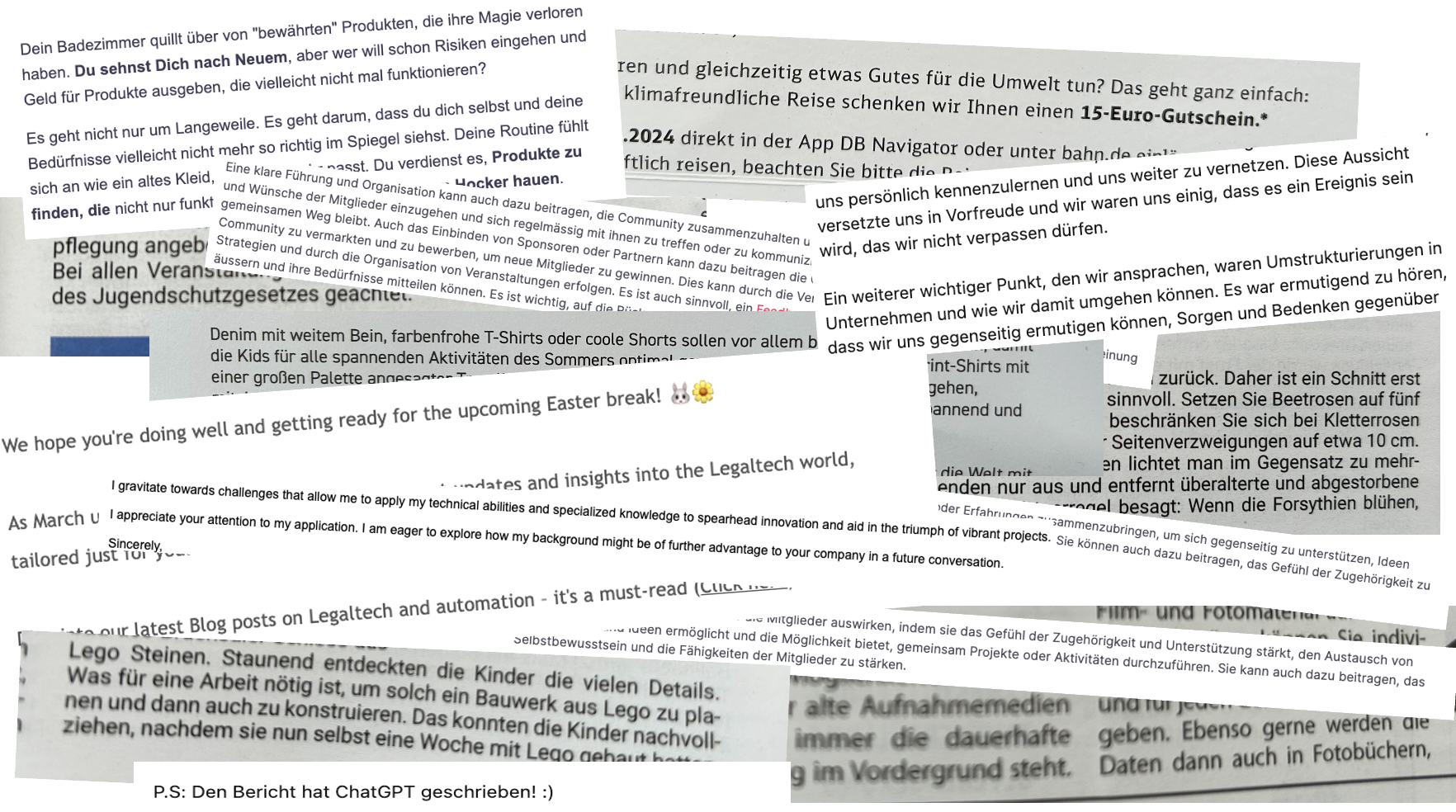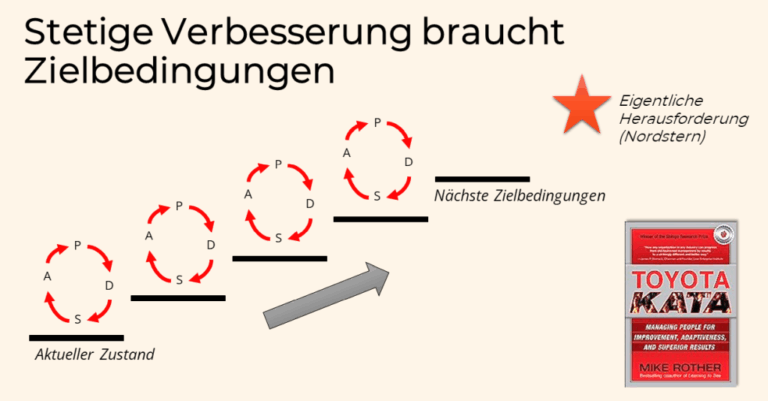Schreiben und Schreiben lassen
Schon wieder ein Artikel über KI, mit KI-generierten Illustrationen, Robotergestalten oder Roboterhänden in bläulichem Licht an einer Tastatur? Nein, brauchen wir nicht, darum geht es mir hier auch nicht. Übrigens auch nicht um die Gegenposition „nur Selbstgeschriebenes ist richtiges Geschriebenes“ mit Bildern von edlen Moleskine-Büchern und Füllfederhaltern.
Nope, lasst uns mal davon weggehen auf eine andere Ebene, nämlich: Was will denn so ein Text, den ich mühsam erstelle, ob mit natürlicher oder maschineller Intelligenz? Und dient er seinem Zweck oder hat er vielleicht Risiken und Nebenwirkungen, oder sagen wir: Auswirkungen, das klingt nicht gleich so gefährlich und technologieavers.
Was für Texte?
In meinem Alltag schreibe ich Texte aus unterschiedlichen Gründen und für unterschiedliche Zwecke. Lassen wir hier mal den privaten Bereich weg mit Todo-Listen, Briefen an Tante Gisela und der Mail an die Stadtwerke wegen der kaputten Straßenlaterne.
Dann sind es im beruflichen Umfeld grob zwei Kategorien von Texten: die eine Art enthält Inhalte oder aufbereitete Informationen, die für einen bestimmten Personenkreis relevant sind. Das sind zum Beispiel Dokumentationen, Fachartikel, Vereinbarungen, Zusammenfassungen.
Die andere Art weist auf die Möglichkeit hin, diese Inhalte und Informationen zu bekommen, also leitet zu ihnen hin oder führt diese ein. Damit meine ich alle Sorten Anschreiben, Begleitbriefe, Newsletter. Diese Texte sind in dem Moment obsolet, wenn das Dokument bearbeitet und abgelegt ist oder wenn der Link zur beworbenen Webseite geklickt wurde. Die Mail wird gelöscht, das Begleitschreiben weggeheftet oder entsorgt.
Gebrauchstexte und Verbrauchstexte
Die ersteren sind Texte zum Gebrauch, mit denen gearbeitet wird und deren Information direkt für einen echten Zweck benötigt wird. Die zweite Sorte sind Verbrauchs- oder sogar Wegwerftexte, ihr Zweck ist der Hinweis auf etwas anderes.
Auch diese Verbrauchstexte sind wichtige Elemente in der Kommunikation mit Kollegen, Kunden, der Öffentlichkeit, also dem Zielpublikum. Ihre Erstellung ist manchmal mühseliger als die der Gebrauchstexte mit den eigentlichen Inhalten.
Die konkreten Fakten, Ereignisse und Zusammenhänge sind erarbeitet, durchdacht und formuliert, und das war eine Menge Arbeit. Jetzt muss das alles nochmal, aber anders! in einem Anschreiben vermittelt werden, inhaltlich und formal korrekt, ansprechend lesbar und ausreichend seriös.
KI als Schreibhilfe
Das ist die Stelle, an der KI wunderbar hilft – es ist immer leichter, fremde Vorschläge zu zerpflücken, als nach der ganzen Inhaltsarbeit noch eigene Vorschläge zu generieren. KI greift auf die Erfahrungswerte und die Vorarbeit von Millionen anderer Menschen in ähnlicher Situation zurück. Auf die zig Muster und Vorlagen, die viele andere Menschen mit Einfühlungsvermögen, Verstand, Routine und der Kenntnis von Zielgruppen und deren mentaler Verfassung erstellt haben.
Super, so wird mir Arbeit abgenommen, der Begleitbrief ist in einem Durchgang fertig, die Ankündigung meiner Veranstaltung verwendet die Stilmittel, Effekte und Schlagwörter, die das Publikum wiedererkennt und anerkennt – mit dem Aufrufen der angebotenen Information, dem Klicken des Links zur beworbenen Veranstaltung. Und hier kommen wir zu den oben genannten Risiken und Nebenwirkungen. Damit meine ich nicht, dass das Internet explodiert oder der Rechner stirbt – nein, ich beobachte bei mir inzwischen diesen Effekt:
Diese von KI mindestens teilgenerierten Newsletter und Kundenanschreiben und Begleitbriefe sind alle prima und erfüllen ihre Zwecke. Die Adressaten bekommen einen anständigen Text und ich musste keine Stunden und Tränen auf die Erstellung dieser Uneigentlichkeiten verwenden.
Sie stellen aber erkennbar eine eigene Unterart von Text dar, die bestimmte qualitative Merkmale hat. Sie sind glatt und gefällig, haben gerade den richtigen Anteil von harmlosem Beliebtheitsvokabular – und irgendwie sind sie alle auf ähnliche Weise minimalinvasiv und weichgespült. Obwohl man sie genau deswegen nur überfliegt und nicht weiter beachtet, setzen sie einen Maßstab und signalisieren „ich bin ein harmloser Einführungstext, in dem es nicht um mich geht, um dich aber auch nicht – ich wende mich an alle und viele, ich bin beliebig und austauschbar.“
Stereotypisierung und Erkennbarkeit
Diese Textmuster, die Wortwahl, bestimmte Satzkonstruktionen und Wiederholungen erkennt man nach einer Weile wieder. Und diese Wiedererkennbarkeit, die die KI-Herstellung ihnen verleiht, versaut gleichzeitig durch ihren künstlichen Geschmack das Werkzeug KI für andere Texte. Nämlich Texte, die eben nicht beliebig ankommen sollen. Texte, die nicht einfach Klicks und kurze Aufmerksamkeit wollen, sondern die einen Inhalt transportieren und eine gezielte Absicht haben.
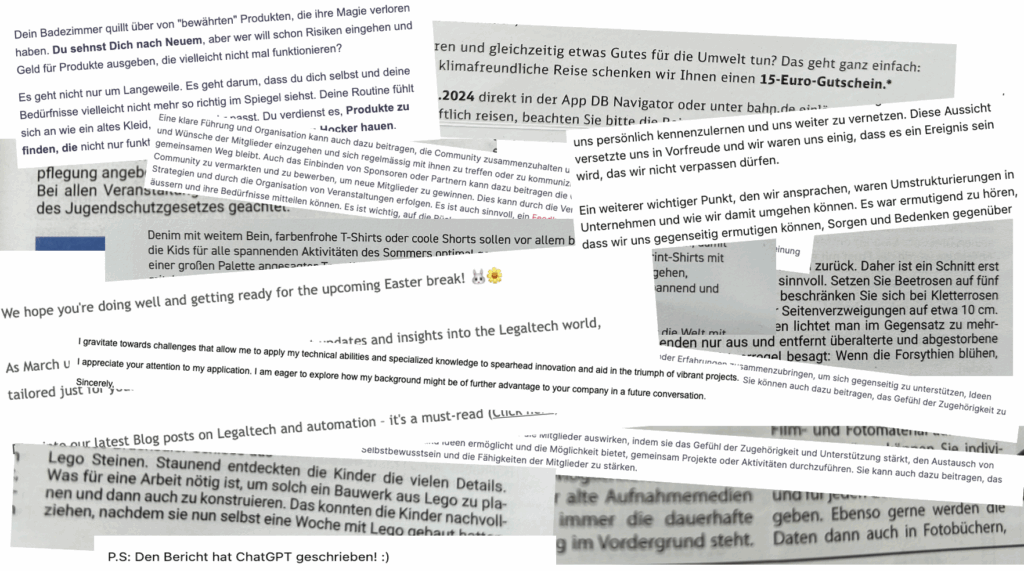
Ein Beispiel: In meinem Firmenpostfach brandet derzeit eine Welle von Bewerbungsspam an. Ingenieure, Marketingspezialisten, Politikwissenschaftler (zu 95 % männlich) schwemmen mir über irgendwelche Wegwerf-Mailadressen Bewerbungen ins Mailfach. Als Einzelfälle sehen sie alle seriös aus – wenn nur diese Anschreiben nicht alle nach dem selben Muster fabriziert wären. Alle verwenden die selben leeren Schlagwörter, die gleichen gestelzten Floskeln in seltsam zusammenhanglosen Textblöcken.
Wenn Gebrauchstexte wie Wegwerfware aussehen
Diese Bewerbungen bringen alle das künstliche Aroma von un-individueller Massenansprache, von Oberflächlichkeit und Mache in mein Postfach und verdammich, ich fühle mich nicht mal mehr ernstgenommen. Nicht nur wegen der unpassenden Qualifikationen, sondern auch, weil diese ganzen Anschreiben so austauschbar sind: die meinen mich doch gar nicht.
Genauso empfinde ich es bei manchen Webseiteninhalten und Forenbeiträgen: Wenn ihr Stil bei mir den Eindruck weckt, dass dieser Text künstlich generiert ist, dann stirbt sofort mein Interesse. Denn wenn etwas erkennbar KI-gemacht ist: wie sieht es dann mit der Zuverlässigkeit der Informationen aus? Was sagt das über die Autoren/Autorinnen und Betreiber des Angebots aus, die sich nicht mal die Mühe machen, ihre eigenen Gedanken zu formulieren, um ihre Leserschaft authentisch anzusprechen? Oder einfach nur ihre Seiten mit Pseudo-Content füllen und nach mehr aussehen lassen wollen?
Schlimmer: nicht nur will ich diesen Text nicht lesen, sondern meine Vorbehalte dehnen sich automatisch auf den ganzen Rest der Webseite aus, auf das, was dort angeboten wird und auf die dahinterstehenden Unternehmen gleich mit.
Es geht also nicht um KI hui oder pfui, Bleistift gut oder doof, Selbertippen ächz oder hurra. Es geht darum, in welcher Sprache und mit welcher erkennbaren Mühewaltung ich Adressaten anspreche und ob sie sich erreicht fühlen. Auch wenn sie das nicht analysieren, sie nehmen es unterschwellig wahr und nun ja, überlegt euch halt genau, wofür ihr die Hilfsmittel einsetzt und was dies indirekt und unbeabsichtigt bewirken kann.