Was sind die Ursachen für Verwaltungsblockaden? Eine Einladung zu einem Kamingespräch.
Am 25. September 2023 trafen sich Peter und der Wolf, um ein Kamingespräch vorzubereiten. Zum Thema „Was blockiert unsere Verwaltungen?“ sind in letzter Zeit einige Beiträge auf unserem Blog erschienen. Aber auch in anderen Medien, in Zeitungen und Beiträgen im öffentlichen Rundfunk, gab es viele interessante Artikel. Daraus entstand die Idee, interessierte FAV-Mitglieder und Leser:innen unseres Blogs zu einem Austausch einzuladen. Als Form haben wir uns ein offenes Gespräch überlegt, das eigentlich kein Ziel hat als einen offenen Austausch. In einer ruhigen Atmosphäre – also am Ausklang des Tages – und mit etwas mehr Zeit als in unseren „Impulsen in der Mittagspause“. Vielleicht 90 Minuten. Und Peter und Wolf fingen gleich damit an, ein paar Thesen zusammenzutragen.
Blockade? Überlastung? Überforderung? – Wie könnten wir es nennen?
Wolf: Veronika hat mir verboten, von „Verwaltungsblockaden“ zu sprechen. Sie meint, dann steigt jeder Leser sofort aus. Aber du siehst, das stimmt nicht. Da schau, zumindest ein Leser ist nicht ausgestiegen!
Aber im Ernst: Die Frage „Was ist das überhaupt, was wir gegenwärtig bei Aufgaben wie Digitalisierung usw. erleben? Wie kann man das nennen?“ – ist natürlich Gegenstand der Diskussion selbst.
Verschiedene Ebenen, verschiedene Themen = ganz verschiedene Faktoren
Wolf: Also suchen wir einmal nach Ursachen für das, was wir jetzt vorerst nicht benennen. Ich glaube, dass es verschiedene Faktoren gibt, je nach Art der Verwaltungen, also Bundesverwaltung, Landesverwaltung, Kommunalverwaltung und natürlich auch Hochschulverwaltung. Und dass die Faktoren zusätzlich von der Wichtigkeit der Themen abhängen.
Fangen wir mal auf der Bundesebene an und mit einem wichtigen Thema: Klimapolitik. Warum geht die Klimapolitik nicht so voran, wie es sachlich nötig wäre?
Da habe ich ein Zeitungsinterview gefunden mit Friederike Otto, Klimaforscherin und Empfängerin des Deutschen Umweltpreises 2023. Otto sagt: „Das Problem ist: Wer reich, gebildet und gut informiert ist, wird fast keine Probleme mit den Veränderungen haben. Man wohnt in gemäßigten Klimazonen, lebt in klimatisierten Häusern und fährt in heruntergekühlten Autos. Dass ist ja einer der Gründe, warum so wenig in Politik und Wirtschaft passiert. Es trifft vor allem diejenigen, die wenig Geld besitzen, in Elendsviertel wohnen und wenig Bildung haben.“
Also Blockadefaktor: Es gibt Menschen, die sich freikaufen können von den Problemen. Und die blockieren dann alle Lösungen, weil sie nichts davon haben. Und die Politik ist ihnen zu Diensten.
Muss man „Verwaltungsblockaden“ und „politische Blockaden“ trennen?
Peter: Du weißt, dass wir da ganz unterschiedlicher Meinung sind. Diese Art von Blockaden, wie du sie gerade genannt hat, ist überhaupt nicht unser Thema. Inkonsistente, widersprüchliche, fehlende Regierungsarbeit, daran kann und soll Verwaltung nichts ändern. Die Verwaltung ist nicht unmittelbar von den Bürgerinnen und Bürgern beauftragt/gewählt. Die Regierung schon. Verwaltungen können kein Reparaturbetrieb für schlechte Regierungsarbeit, für schlecht gemachte Gesetze sein. Was Verwaltungen können ist, Verwaltungsarbeit gut zu machen. Das liegt in ihrer Gestaltungsmacht.
Wolf: Ich bin da ganz anderer Meinung. Aber du hast recht. Das ist häufiges Diskussionsthema zwischen uns. Und ich glaube, auch im FAV gibt es diesbezüglich unterschiedliche Strömungen.
Oder doch überall die gleichen Faktoren?
Peter: Ich habe auch bezüglich der Faktoren eine andere These als du: Die Blockaden der verschiedenen Verwaltungen unterscheiden sich nicht, weil alle Verwaltungen gleiche (Aufbau-)Strukturen aufweisen. Sie sind in der Regel hierarchisch aufgebaut und überall gilt das Zuständigkeitsprinzip. Deswegen gibt es mehr oder weniger ähnliche Blockaden bzw. Probleme bei der Prozessierung von Entscheiden, bei der Kommunikation, bei der Umsetzung von Aufgaben.
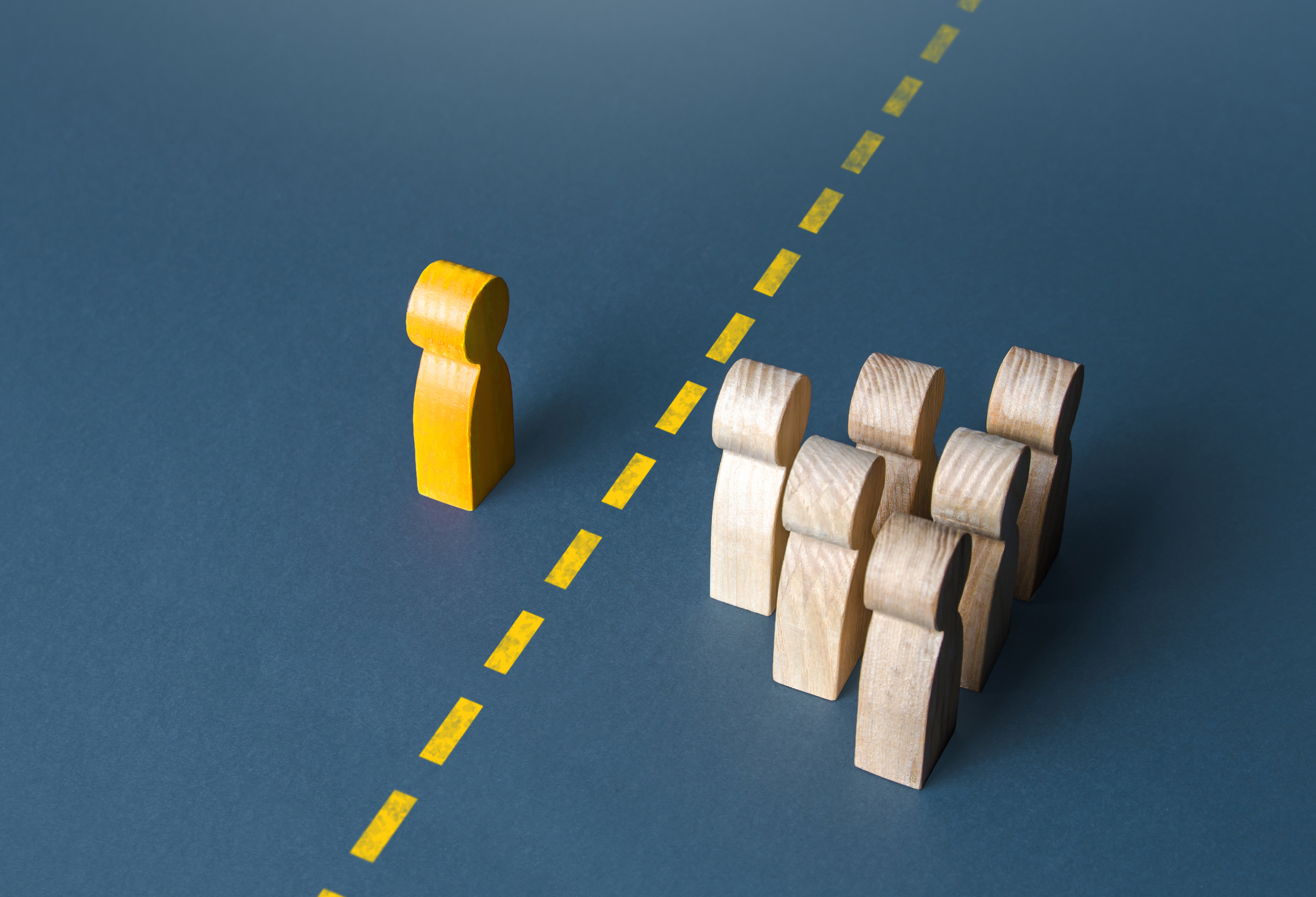
(Quelle: PIXNIO, Bild iStock-1355810748)
- Hierarchische Positionen sind mit jeweils einer Person besetzt. Wenn diese nicht funktioniert, dann funktioniert der gesamte Bereich darunter schlecht oder gar nicht.
- Menschen bleiben lange in Verwaltungen (mehre Dekaden sind keine Seltenheit). Entsprechend gravierend sind Fehlbesetzungen.
- Vorgesetzte agieren gerne als „Entscheider“, was bedeutet, dass sie gerne und viel qualifizierte Sachbearbeitung machen. Dadurch bleibt keine Zeit für Führung im eigentlichen Sinn.
- Jede Führungsebene meint, sich in Entscheiden abbilden zu müssen, wodurch Arbeitsergebnisse von Untergebenen oder auch Projektgruppen hemmungslos verändert, verfälscht, obsolet gemacht werden.
- Zuständigkeiten führen zu Revierverhalten (Verteidigung, Abgrenzung, Wagenburg, …).
- Diese Art der Aufgabenerledigung erzeugt unglaubliche Mengen sinnloser Arbeit ohne Impact und in der Folge zu Frustrationen bei den MA.
Besondere Blockadefaktoren auf kommunaler Ebene
Wolf: Für mich gibt es aber noch andere Faktoren, die nicht auf internen Strukturen beruhen, sondern auf dem Verhältnis zur Außenwelt. Zum Beispiel auf kommunaler Ebene gibt es eine relativ hohe Zahl von Stakeholdern, die alle ihre eigene Sicht auf die Probleme haben und alle gehört werden wollen/müssen und eine konkrete Fragestellung in ihre Richtung zerren.
Ein Beispiel, was ich konkret nachverfolgt habe: Die Ausländerbehörde einer Großstadt ist völlig überlastet. Sie hat 35.000 unbearbeitete E-Mails in ihrem Eingangspostfach. Allein um einen Termin zu bekommen, um einen Antrag einzureichen, brauchen Anspruchsberechtigte acht Monate. Existenzen werden zu Boden geworfen, weil die Arbeitserlaubnis ausgelaufen ist.
Jetzt kommen die Stakeholder mit ihren Stellungnahmen. Die Gewerkschaft sagt: Wir brauchen mehr Stellen!. Dann wird alles gut. Die Stadt sagt: Aber wir kriegen niemanden. 20% der Stellen sind unbesetzt oder langzeit-krank. Die größte Fraktion im Stadtrat sagt: Es gibt zu viele Asylbewerber. Daher kommt die Überlast. Wir müssen die Außengrenzen dicht machen. Der Ausländerbeirat sagt: Wir haben Hilfe angeboten, z.B. mit ehrenamtlichen Dolmetschern. Aber das Amt nimmt die Unterstützung ja nicht an. Das Amt sagt: Danke für das Angebot, aber wir dürfen nur vereidigte Dolmetscher beschäftigen. Usw.
All diese Statements sind das, was die Amerikaner „TBU“ nennen: „True but useless“, „wahr aber nutzlos“. Wie lange, liebe Ver.di, wird es denn dauern, bis 30 neue Stellen bewilligt und besetzt sind? Und, liebe CDU, sollen die Beschäftigten warten, bis die Festung Europa bis ums Mittelmeer komplett dicht ist? Für die Frage: „Wie kriegen wir die 35.000 E-Mails bearbeitet?“ sind das alles „TBU“. Aber die Diskussion dreht sich im Kreis, ohne voranzukommen. Aus meiner Sicht ein erheblicher Blockadefaktor.
Peter: Das finde ich einen interessanten Aspekt. Die Stakeholder agieren oft total vorhersehbar aus ihrer Denkblase, ihrem Silo, ihrem Revier heraus. Sie stellen immer gleichartige – mit anderen Stakeholder unvereinbare – Forderungen, statt sich um eine Lösung der konkreten Probleme zu kümmern.
Einladung zum Kamingespräch

- Das Ziel des Austauschs ist der Austausch. Neugierig zuhören, eigene Sichten beitragen – das ist die Grundhaltung. Chance zur „Serendipität“: Neue Ideen finden, ohne gezielt gesucht zu haben.
- Aber vielleicht ergibt sich auch etwas, was wir oder einige von uns weiter zusammen machen wollen zum Thema.
- Hier die kostenlose Anmeldung auf Eventbrite. Mit der Anmeldung erhaltet ihr einen Link auf die Eventseite und dort liegt der Link auf die Zoom-Videokonferenz, auf der das Ganze stattfindet.
- Die Zahl der Teilnehmer ist auf 30 begrenzt (wir wollen noch experimentieren, um eine gute Größe herauszukriegen). Wenn das Interesse größer ist, machen wir einen Folgetermin.
- Mit der Anmeldung erhaltet ihr auch einen Link auf ein Miroboard, auf dem ihr schon vor unserem Kamingespräch Ideen, Erfahrungen und Beiträge hinterlegen könnt.



