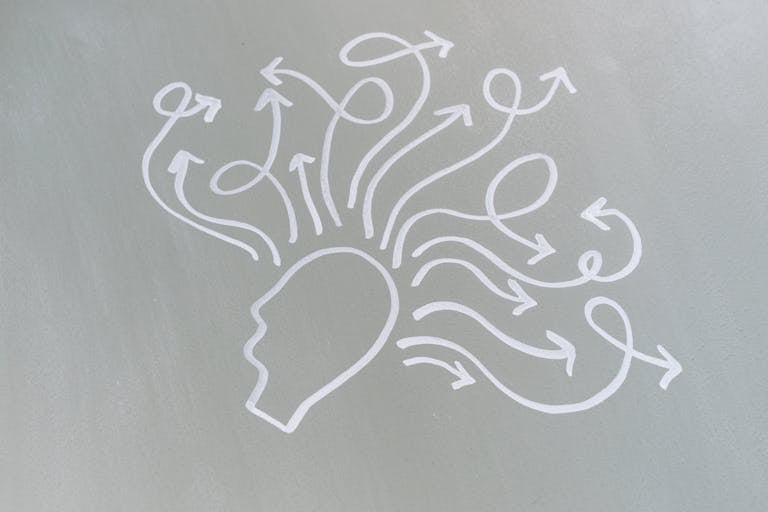Allen Stühlen zum Trotz: Wieviel Definition braucht’s wirklich?
Eine Antwort auf Veros Blogbeitrag vom 23. Mai 24:
Vero:
Nach meinem letzten Blogbeitrag „Von der Gefährlichkeit von Stühlen“ kam mein überaus geschätzter Kollege Dominik auf mich zu. Er fand den Artikel zwar schon gut, brachte aber eine höchst zentrale, spannende und notwendige Erweiterung des Themas ins Spiel. Eine, die gerade auch Kernverwaltungen und auch Hochschulen betrifft. Die Diskussion darüber wollen wir hier im Blog für euch alle lesbar weiterführen…
Zur Erinnerung – darum ungefähr ging es im erwähnten Blogbeitrag:
„In der Arbeitswelt gibt es viele, brandgefährliche und oft nicht oder zu spät erkannte Stühle. Das sind Begriffe wie «Qualität» «Projekt» oder auch «schnell zu erledigen»:
Jede und jeder kennt den Begriff und hat eine mehr oder minder präzise Vorstellung davon – und obwohl alle Gesprächsbeteiligten den gleichen Begriff benutzen, hat jede und jeder einen anderen Ausschnitt des Konzepts im Kopf. Das allerdings oft, ohne es zu merken. (…)
Stühle verlieren schon sehr viel an Gefährlichkeit, wenn sie situativ früh als Stühle enttarnt werden.
In vielen meiner Teams ist in Gesprächen plötzlich ein «Achtung, Stuhlgefahr» zu hören. Oft sind es die am wenigsten direkt betroffenen Anwesenden, die die Stuhlgefahr erkennen und ausrufen. Und dann wird zusammen eruiert, ob das gleiche Wort für alle auch wirklich ver-gleich-bares meint —- und wo in den abweichenden Vorstellungen der kleinste gemeinsame Nenner liegen könnte.“(…)
Und da hat Dominik eingehängt und auf eine Gefahr aufmerksam gemacht.
Dominik:
Es ist richtig, Klarheit zu schaffen, wovon gesprochen wird, ist zentral.
Aber und auch: Die Kehrseite der Medaille zeigt sich des Öfteren in der Arbeit mit Expert:innen. Da heisst es dann: „Bevor wir bereit sind, Inhalte zu diskutieren, wollen wir eine (von allen validierte) Definition.“
Und das dient dann in erster Linie oftmals nicht dem Wunsch nach Klärung, sondern vielmehr… als Strategie zur Vermeidung der „heissen Kartoffeln“.
Vero:
Da kann ich dir nur von Herzen Recht geben. Wie oft haben wir mit Teams, besonders eben in Expert:innenorganisationen, Stellvertreterdebatten und Vermeidungsschlachten geschlagen, weil sich die Beteiligten nicht auf ein Thema einlassen wollten oder konnten.
Weil es sie direkt betraf und die professionelle Expert:innendistanz fehlte oder es in eine Unvorhersehbarkeit führte, in der sie sich nicht kompetent fühlten.
Das haben viele Expert:innen nicht so gern. Und haben wenig Routine, solche Situationen auszuhalten.
Was schlägst du vor, wir könnten wir mit Expert:innenstühlen (fast hätte ich Throne geschrieben….) umgehen?
Dominik:
Eine schwierige Frage, wie die Erfahrung zeigt! Es gilt sicherlich situativ die Situation einzuschätzen:
- Wieviel „Platz geben“ ist nötig, damit überhaupt (anschliessend) eine Bereitschaft zur Diskussion er eigentlichen Kernthematik da ist?
- Wieviel als „Rahmen setzen“, damit die Stellvertreter-Diskussion nicht ausufert und gleichzeitig nicht zu grundsätzlichem „Abblocken“ führt?
- Wieviel „Salz in die Wunde“, um das Kernproblem hervorzuheben?
Ein Kochrezept gibt es entsprechend wohl leider nicht (oder zum Glück, sonst bräuchte es uns Seiltänzer:innen gar nicht). Ein paar Grundsätze sind aber meist hilfreich, denke ich. Spontan kommen mir folgende in den Sinn:
a) Das verwenden von in der Wissenschaft breit akzeptieren Definitionen (mit Autor:in, Quelle, etc.), ggf. 2 zur „Auswahl“ , nach der Logik, die Diskussion wird eh geführt, versuchen wir sie zu kanalisieren/fokussieren.
b) diese Definitionen nicht als absolut hinstellen, sondern taktisch als „Arbeitsdefinition“, mit der wir anschliessend mal schaffen, um weiterzukommen.
c) dem „Urinstinkt“ oder „Grundbedürfnis“ der Expert:innen zur Grundsatzdiskussion in einem klaren, definierten, moderierten und zeitlich eng begrenzten Rahmen Rechnung tragen
d) wenn von der Gruppengrösse her möglich, sicherstellen, dass alle individuell gehört werden resp. in ähnlichem Umfang zu Wort kommen. Ziel ist die Wertschätzung jeder Person, das Einbeziehen und hörbar machen der Leiseren und das Relativieren der Lauteren
Aber Du hast da zweifellos noch weitere Ideen, oder?

Vero:
Viele hast du schon genannt. Weitere Ideen, die ich zum Einsatz bringe, sind zum Beispiel häufig Angebote, auf ungefährliche Art ins vorliegende Thema einzusteigen und so die Vermeidungsreflexe zu reduzieren:
- Niederschwellig und ganz wörtlich „Standpunkt beziehen“ und die kollektive Meinung sichtbar machen.
Visualisierende Skalen und andere Raumaufstellungen können das leisten. Und das dient dann häufig als Gesprächseinstieg in die Deltas zwischen den partikularen Ansichten. Die helfen dann dabei, das fokussierte Thema einfacher zu betreten und nicht auf theoretische Diskussionen auszuweichen, bzw. sie dadurch auf etwas später zu verschieben, wenn der Einstieg ins Thema bereits stattgefunden hat. - Ressourcenbasiertes Vorgehen.
Mithilfe von einfachen, aber oft überraschenden Methoden und Musterbrüchen aufzuzeigen, wo Fähigkeiten, Stärken, Erfolge und Talente der Gruppe liegen und wie sie verstärkt nutz- und spürbar gemacht werden können.
Hier kommt dann häufig echte Neugier ins Spiel und hilft beim Weiterarbeiten.
Solche Vorgehensmöglichkeiten, von denen es noch viel mehr gibt, sollen dazu führen helfen, dem Urinstinkt zur Grundsatzdiskussion oder zur Vermeidung eine spannende Alternative zur Seite zu stellen, die hilft, sich auf ein Thema einzulassen.
Generell bleibt zu sagen,
- dass Expert:innenorganisationen nicht ganz anderen Regeln folgen als der Rest der Welt, aber durchaus schon Eigenheiten haben, denen es Rechnung zu tragen gilt.
- dass Stühle halt gefährlich sind – manchmal als Stühle oder auch manchmal als Ausweichmanöver.
Und dennoch:
Stühle verlieren schon sehr viel an Gefährlichkeit, wenn sie situativ früh als Stühle enttarnt werden.
Ganz gleich, welche Art Stühle es sein mögen….
Beitragsbild Stühle, Quelle: http://diemoebelbloggerin.com/2013/05/29/locker-zusammengestellter-stuhle-mix/