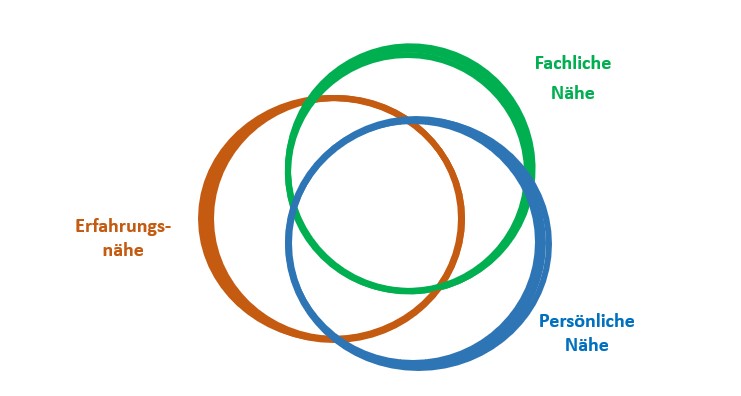Austauschgruppe zur Einführung der E-Akte: Wir organisieren ein Wissensmanagement
Wir vom Forum Agile Verwaltung sind wieder mal ein bisschen am Experimentieren. Wir möchten gerne den Nutzen unserer Arbeit für unsere Mitglieder und Mitmacher erhöhen, und zwar in Richtung einer besseren Zirkulation von Wissen. Über das Schreiben von Blogbeiträgen hinaus, die immer unilinear sind: von Autor:innen zu Leser:innen.
Jetzt kann man lange theoretische Erörterungen anstellen, was Wissen überhaupt ist und wie man es mit Hilfe des Internets gemeinsam besser und schneller entwickeln kann. Da gab es Anfang der 2000er Jahre sehr große Erwartungen von einer kommenden „Schwarmintelligenz“ /Anmerkung 1/. Und es gibt aktuell ganz kritische Stimmen wie z.B. die von Armin Nassehi, die das als romantische Träumerei abtun. /Anmerkung 2/

Aber probieren wir es doch mal aus.
Wer ist die Zielgruppe eines Wissensmanagements?
Es gibt ganz verschiedene Anliegen, die uns in unseren Projekten umtreiben. Die Ausgangssituation ist nach unserer Vorstellung jeweils ähnlich:
- Wir haben ein Orga-Projekt mit IT-Komponente. Zum Beispiel „SAP S/4HANA einführen für bestimmte Personalprozesse“, „OZG-Leistungen implementieren“, „Campus-Management beschaffen“ oder „E-Akte einführen“. Also ein Projekt, in dem es um Änderung von Abläufen als auch um deren Abbildung in einer Software geht.
- In diesem Projekt haben wir eine Rolle als Projektleiter oder künftiger Key-User oder Anwendervertreter.
- Wir fühlen uns unsicher. Unser Wissen scheint immer hinter den Notwendigkeiten hinterher zu hinken. Und wir haben unser Nichtwissen unterschätzt. Wir hecheln hinter Deadlines her und das Gefühl, kaum mal Gelegenheit zum Nachdenken zu haben.
- Viele Fragen unterschiedlicher Art tauchen auf. Es gibt technische Fragen („Gibt es eine Schnittstelle von Software X zu unserem Archivsystem Y?“). Und es gibt eher strukturelle Fragen („Wie überzeuge ich unsere Führungskräfte, uns genügend Ressourcen für das Projekt zu geben?“)
An diese Zielgruppe in einer ähnlichen Situation adressieren wir unser Wissensmanagement.
Ein konkretes Beispiel
Um zu experimentieren und praktische Erfahrungen zu sammeln, haben wir uns als Thema „Projekte zu Einführung von enaio in Verwaltungen“ ausgesucht. Dazu gibt es in Deutschland ziemlich viele Projekte, der Wissensbedarf ist groß und wir vom FAV haben in unseren Brotjobs mit einigen dieser Projekte zu tun, verfügen also über einige Erfahrungen.
Dazu haben wir im Januar 2023 eine Austauschgruppe zu diesem Thema gegründet. Sie besteht vorwiegend aus Projektleiter:innen. Die Gruppe wird vom FAV moderiert und trifft sich alle 6 Wochen an einem Donnerstagnachmittag für 1:30 Stunden. Dabei werden Fragen gestellt und im Kreis der Anwesenden beantwortet. Wenn keiner eine Antwort hat, kann eine kleine Arbeitsgruppe beauftragt werden, bis zum nächsten Treffen zu recherchieren. Derzeit gibt es z.B. eine AG „Welche Bestandsdokumente sollen gescannt werden? Tipps für eine Migrationsstrategie.“
Aktuelle Netzwerke und ihre Grenzen
Wir haben festgestellt, dass es bereits einige Netzwerke zum Thema gibt, meistens regional organisiert. Es gibt ein Netzwerk der Landkreise Baden-Württembergs, ein anderes in Niedersachsen und eines in Sachsen-Anhalt. Das ist auch gut so. Wenn wir einen riesigen Zusammenschluss mit 200, 300 Leuten hätten, kämen wir vermutlich langsamer in den Austausch als in einem der jeweils überschaubaren Kreise.
Aber es gibt auch Nachteile. Ein Hauptproblem solcher Gruppen ist die Dokumentation. Jemand stellt eine Frage, und irgend jemand sagt: „Das hatten wir doch schon mal! Irgendwann vor 6 Monaten. Aber was war damals die Antwort?“
Das betrifft vor allem die technischen Themen. Die sind durch genaue Fragestellungen gekennzeichnet und relativ eindeutige Antworten. (Bei strukturellen Fragen der Art „Habt ihre einen klassischen oder einen prozessorientierten Aktenplan und wie pflegt ihr den?“ wird es komplexer und bei Anliegen wie „Wie führe ich meine Führungskraft?“ gibt es gar keine eindeutigen Antworten mehr.)
Eine Datenbank als Experiment
Deshalb wollen wir uns als Nächstes auf technische Fragen konzentrieren und die in einer Datenbank abbilden. Dabei arbeiten erst einmal unser FAV-Netzwerk und das der Landkreise Baden-Württembergs zusammen – wenn sich andere noch beteiligen möchten, sind sie herzlich eingeladen.

Das Netzwerk der Landkreise hat schon eine Datenbank zur Verfügung, die bislang vor allem zum Austausch zu OZG-Projekten genutzt wird. Die werden wir auch für unser Thema nutzen können. Dafür hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich die nötigen Strukturen überlegen will (z.B. Schlagwortlisten und ähnliches). Und dann soll diese Datenbank allen Interessent:innen zur Verfügung gestellt werden.
Das erste Treffen der Arbeitsgruppe findet am 15. September statt. Wenn sich noch andere daran beteiligen möchten, sind sie herzlich eingeladen.
Wie gesagt, es handelt sich um einen Versuch, der auch scheitern kann. Bei technischen Fragen geht es um Wissensverteilung (nicht um Wissenserzeugung wie bei strukturellen Fragen). Jemand hat Wissen und soll es in die Datenbank einspeisen, damit andere das Wissen abrufen können. Aufwand und Nutzen sind asymmetrisch verteilt. Solche Systeme leiden unter dem Risiko des Trittbrettfahrens. D.h. es gibt Leute, die nie etwas einspeisen und immer nur Wissen abzapfen. In der Regel müssen Dienstleistungen mit Trittbrettgefahr (dazu zählt z.B. auch der Deichbau) öffentlich finanziert und bereitgestellt werden, weil private Netzwerke überfordert sind. Vielleicht ist die Skepsis Armin Nassehis ja berechtigt.
Aber wir sind ja Optimisten. Mal schauen, ob es uns doch gelingt, der Asymmetrie entgegenzuwirken. Wir müssen Aufwand und Ertrag des Arbeitens an der Wissensdatenbank gut empirisch beobachten und uns regelmäßig Rechenschaft ablegen.
Wer sich für unsere E-Akten-Austauschgruppe interessiert, findet hier mehr Informationen und einen Link zum Kontaktformular.
Wer am Aufbau der Wissensdatenbank mitmachen will, schickt eine E-Mail an wolf.steinbrecher[ätt}agile-verwaltung.org.
Anmerkungen
/1/ James Surowiecki: The wisdom of crowds. Why the many are smarter than the few and how collective wisdom shapes business, economies, societies and nations. London, 2004
/2/ Armin Nassehi: Die letzte Stunde der Wahrheit. Kritik der kompexitätsvergessenen Vernunft. 2. überarbeitete Auflage, kursbuch.edition, 2017, Seite 78 f.
Und natürlich gibt es noch das Buch von Ikujiro Nonaka und Hirotaka Takeuchi: „Die Organisation des Wissens“ aus dem Jahr 1995. Dort geht es aber vor allem um Wissensentwicklung innerhalb eines Unternehmens, nicht zwischen verschiedenen Organisationen.