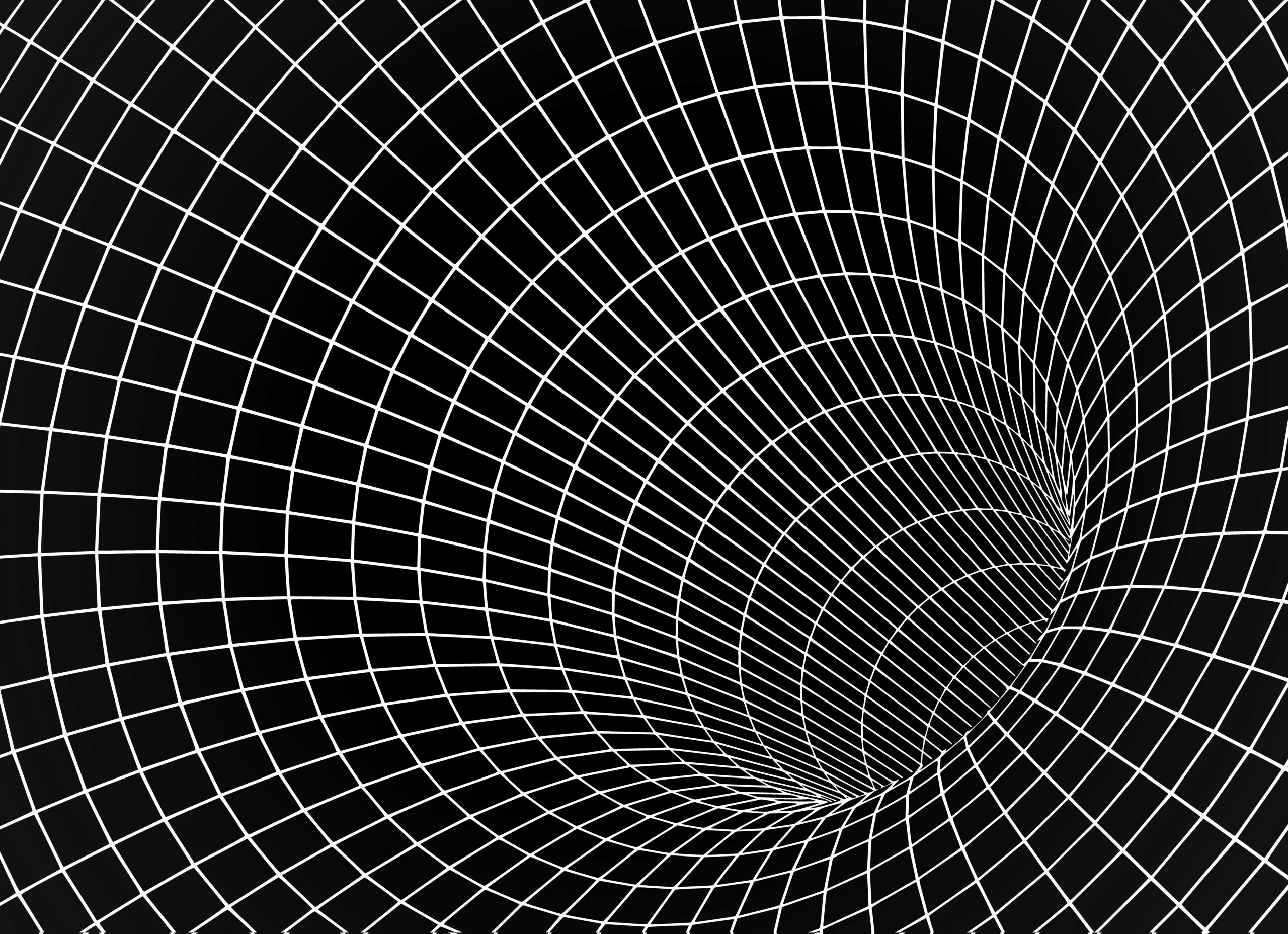Agilität und Evaluation
Im Februar dieses Jahr habe ich bereits über partizipative Evaluation in Bürger*innenbeteiligungsprozesse geschrieben. Die Idee der Evaluation und wie sie mit agilen Werten zusammenhängt steht in diesem Beitrag im Mittelpunkt.

Agiles Manifest – was war das noch mal?
Für alle, die neu bei agilem Arbeiten sind – und für manche, die länger dabei sind, lohnt es sich das Agile Manifest noch mal in Erinnerung zu rufen. Das agile Manifest ist kein theoretischer Überbau oder akademisches Konstrukt, sondern eher ein Leitfaden. Vier Werte, zwölf Prinzipien, auf den die Zusammenarbeit mit Kind*innen aufgebaut wird und auf die immer wieder zurückgegriffen wird. Es stellt Handlungsmaxime dar, die aus der Praxis entstanden sind und die Praxis gestalten sollten.
Für den Beitrag hier möchte ich zwei Leitsätze aufgreifen, die auf das Themenfeld „Evaluation“ besonders einspielen:
Die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams.
und
In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an.
Diese zwei Leitsätze zeigen, wie tief das Verständnis 1. einer regelmäßigen Evaluation in dem agilen Manifest verankert ist und 2. wie sehr agiles Arbeiten von einer gemeinsamen, geteilten, klaren Zielvorstellung lebt. Denn Selbstorganisation kann nur dann gut funktionieren, wenn für alle klar ist, wo die Reise hingeht. Und es kann nur dann funktionieren, wenn immer wieder geschaut wird, dass sich alle auf dem gleichen Weg befinden, und in die gleiche Richtung laufen. Die beiden Prinzipien bedingen sich also gegenseitig.
Reviews als eine Form der (regelmäßigen) Evaluation
In agilen Projekten ist ein regelmäßiger Blick auf den Prozess in Form eines Reviews vorgesehen. Hier wird geschaut, oft gemeinsam mit dem Kunden oder der Kundin, ob der Fortschritt und das Produkt sich in die richtige Richtung entwickelt. In meiner Tätigkeitsbereich, die sich vor allem mit Bürgerbeteiligungen sich befasst, können Reviews (auch wenn ich sie oft nicht so nenne) das Projekt in eine neue Richtung lenken.
Besonders wertvoll ist es, wenn neue Kenntnisse dazu kommen, Ziele umformuliert werden oder ganz in Frage gestellt werden, oder Anforderungen an das Produkt sich verändern. Wenn regelmäßige Feedbackschleifen eingearbeitet sind, so wie es der zweite Leitsatz „In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an“, kann ein Team auf die Bedürfnisse der Bürger*innen besser eingehen.
Ein Beispiel aus der Praxis: Ein kommunaler Prozess mit Bürgerbeteiligung beginnt mit dem Ziel, einen neuen Spielplatz zu entwerfen. In einer Feedbackschleife wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine Kindergruppe im Kindergarten im Quartier bald ein inklusives Konzept einführen wird und zwei Kinder mit Rollstuhl dazu kommen. Das Team kann die Anforderung, einen Vogelnestschaukel einzubauen, noch rechtzeitig in die Planung aufnehmen.
Die Retrospektive als eine zweite Form der (regelmäßigen) Evaluation
Prozesse arbeiten oft mit der Vorstellung von Zielen, Messgrößen und angestrebte Werte. Es wird am Anfang eines Prozesses diskutiert, was bei dem Prozess entstehen soll (der Output) und was man damit bewirken möchte (der Outcome). Ziele werden formuliert, die das Abbilden und Indikatoren entwickelt, um das Ganze zu operationalisieren. Dabei kann die Auseinandersetzung mit dem Rollenverständnis innerhalb des Teams, mit Kommunikationsregeln und mit Grundlagen der Zusammenarbeit ein wertvoller Teil dieser Auftaktsituation. Und auch das regelmäßige Schauen darauf, dass diese Grundlagen eingehalten werden. Diese Art der Evaluation, die Retrospektive zielt eher im Gegensatz zu Review darauf ab, das Verhalten im Team, die Zusammenarbeit und die Spielregeln zu reflektieren und wird in weniger kurzen Zeiträumen durchgeführt[1]. An anderer Stelle in diesem Blog hat Thomas Michl dazu geschrieben: „die Retrospektive richtet sich in erster Linie auf den Prozess der Zusammenarbeit und damit an das Team – nicht an die Anspruchsberechtigten[2].“ Auch Corinna Höffner hat einen Beitrag zum Thema Retrospektive hier im Blog veröffentlicht.
An welcher Stelle ein agiles Denken besonders bedeutsam ist
Wenn in einem Projekt begonnen wird, bevor über die Erfolgsindikatoren gesprochen werden ist es umsowichtiger, dass Retrospektiven eingebaut werden, um die Motivation zu stärken und Selbstorganisation zu ermöglichen. Mögliche Fragen können sein: Was wollt ihr erreichen? Wie wichtig ist für euch der Prozess und wie wichtig ist das Produkt? Was passiert, wenn ihr im Laufe des Projektes entdeckt, dass die ursprünglichen Ziele, und somit auch die Indikatoren, sich verändert haben? Wie geht ihr damit um, wenn während des Projektes Reibung entsteht?
Ein Beispiel: In einem Sozialunternehmen wird in einem kleinen Team an einem öffentlichkeitswirksamen Auftritt gearbeitet. Ein Flyer ist in den letzten Zügen, als das Team sich noch mal über das Ziel ihres Auftritts austauscht. Ein Teil des Teams möchte mit dem Auftritt die Vorzüge ihrer Arbeit für die Nutzer*innen der Dienstleistungen präsentieren, der andere Teil mehr Fördergelder einwerben. Ein eindeutiges „Produkt“, das beide Ziele abdeckt, gibt es nicht. In einer Retrospektive erkennen die Miterbeiter*innen, dass sie viel Zeit mit der Auswahl des Mediums verbracht haben und wenig Zeit mit dem eigentlichen Ziel des Auftritts. Sie erkennen, dass beide Ziele wichtig sind und besprechen die Vor- und Nachteile des vorhendenen Flyers. Aus der Retrospektive gehen klare Richtlinien vor, wie sie in künftigen Projekten miteinander kommunizieren wollen.
In diesem Beispiel werden beide Ebenen der Evaluation klar, zum einen die prozessbezogene und zum anderen das Reflektieren der Teamarbeit. Beide Ebenen finden sich in agilen Projekten wieder durch das Einbauen von Reviews und Retrospektiven und eignen sich für das Arbeiten in multiplen Kontexten.
[1] https://geekbot.com/blog/sprint-review-vs-sprint-retrospective-the-critical-difference/
[2] https://agile-verwaltung.org/2018/11/22/aus-der-agilen-methodenkiste-sinn-und-zweck-des-reviews-und-der-retrospektive/