New Work und Agilität – verständlich erklärt – Glossar von A bis Z – Teil 1
Backlog, Timeboxing und VUKA – diese Begriffe hören sich für viele Menschen (nicht nur) in der Verwaltung an wie Volltreffer aus dem Buzzword Bingo. Kein Wunder also, dass das agile Kauderwelsch in Behörden erst mal auf Zurückhaltung oder gar Ablehnung trifft. Fangen wir allerdings an, uns in der agilen Welt umzuschauen, kommen wir an Ausdrücken wie Daily oder Scrum kaum vorbei – und dann geht es uns wie einer Community von Surfern, Börsenspekulantinnen oder Verwaltungsexperten: unter Fachleuten ist klar, worum es sich bei einer Aktenverfügung, einem Bescheid oder einer Postzustellungsurkunde handelt, ohne dass wir groß drum rum reden müssen. ;-))
Foto: Bild von Wälz auf Pixabay
Mit meiner Serie „Agilität – Glossar von A-Z“ möchte ich Licht ins Dunkel der agilen Buzzwords bringen, so dass Du das nächste Mal einigermaßen mitreden kannst, wenn es um Sprints, Design Thinking und Co. geht. Wir fangen in Teil 1 der Serie an mit ein paar allgemeinen Ausdrücken, die Dir beim Einstieg in die Blase „Agilität“ begegnen. In der Fortsetzung wird es dann mehr um Methoden und Techniken wie zum Beispiel das Kanban Board gehen.
Agiles Manifest und agile Prinzipien – Das Agile Manifest ist ein Dokument, das im Jahr 2001 von einer Gruppe von amerikanischen Softwareentwicklern veröffentlicht wurde. Angesichts mäßig erfolgreicher Projekte diskutierten sie Verbesserungsmöglichkeiten und beschrieben vier agile Werte und zwölf Prinzipien, um bessere Ergebnisse zu erreichen. Das Manifest gilt als Fundament des agilen Projektmanagements (SCRUM) und agiler Denkweisen. Die Werte und Prinzipien beschreiben unter anderem iteratives und inkrementelles Vorgehen, die Bereitschaft zur Interaktion mit dem Kunden während des Erstellungsprozesses und die Idee der kontinuierlichen Verbesserung. Selbst späte Änderungswünsche im Entwicklungsprozess gelten als willkommen. Einige dieser Prinzipien sind bereits aus Konzepten des Lean – und Total Quality Managements bekannt. Die Prinzipien können Verwaltungen bei der Gestaltung von (digitalen) Abläufen und Leistungen dazu dienen, kundenorientierter zu agieren. Teams können sie als „Anleitung“ nehmen, wie die Zusammenarbeit in Projekten und Arbeitsgruppen gelingen kann und wie bessere Ergebnisse entwickelt werden können. Das agile Manifest ist in der deutschen Version unter folgendem Link zu finden: https://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html, die agilen Prinzipien unter dem Link https://agilemanifesto.org/iso/de/principles.html (abgerufen am 26.08.2024). Einen Beitrag von Thomas Michl dazu findest du hier.
Agile Transformation – Mit agiler Transformation ist der Wandel einer gesamten Organisation oder eines kompletten Bereichs gemeint, um agil zu werden. Dabei werden tiefgreifende Veränderungsprozesse in Gang gesetzt, die umfassend sind und alle Ebenen betreffen: die Haltungen der Menschen, die Vorgehen, die Strukturen und Abläufe, die Kultur. Ziel der Transformation ist es, Voraussetzungen zu schaffen, flexibler zu werden, sich schneller an die sich stetig verändernde Umwelt und an neue Anforderungen anpassen zu können – kurz: agiler zu werden. Arbeitsbedingungen werden so gestaltet, dass sie Innovation, Kreativität und Eigenverantwortung fördern. Letztlich soll die Organisation dadurch erfolgreicher werden und sich für die VUKA-Welt gut aufstellen können. Die ING Diba hat einen solchen Wandel in eineinhalb Jahren vollzogen und nennt sich die erste agile Bank. Viele Verwaltungen haben Transformationsprozesse gestartet, um agiler und moderner zu werden. Wenn sie auch nicht in der gesamten Organisation ihre Strukturen agil aufstellen, so werden doch Teilbereiche oder bestimmte Teams, in denen es sinnvoll ist, anders organisiert.
Agilität – Agil zu sein bedeutet zunächst, sich wendig und flexibel an Veränderungen schnell anpassen zu können, je nach Situation auch proaktiv. Diese Eigenschaften werden auf Organisationen übertragen. Die Dynamik der VUKA-Welt gilt für Unternehmen am Markt als große Herausforderung unserer Zeit. Auch Behörden erleben die Schnelllebigkeit und nicht mehr zuverlässig einzuschätzenden Bedingungen als komplex und schwierig zu handeln. Agilität gilt als Konzept, mit dem Organisationen diesem Phänomen begegnen können. Verwaltungen, die agil werden wollen oder sind, nutzen die agilen Prinzipien, Methoden und Techniken. Sie setzen neben der herkömmlichen Aufbaustruktur, den üblichen Routinen und bewährten Abläufen auf parallele Strukturen und Teams, Projektgruppen und Netzwerke, wenn auch nur in bestimmten Bereichen. Die Beschäftigten können kreativer, flexibler und souveräner in nicht absehbaren oder planbaren Situationen handeln und entscheiden als Führungskräfte, die einzelne Entscheidende sind. Merkmale von Agilität in Behörden sind Menschen mit einer Haltung, die sich am agilen Manifest orientiert. Dazu gehört, die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, transparent und iterativ vorzugehen, kontinuierlich zu lernen und den selbstorganisierten Teams zu vertrauen. Dafür braucht es in der Organisation entsprechende Spielräume und Vereinbarungen der handelnden Personen. Eine wichtige Rolle haben dabei Führungskräfte, die diese (parallelen) Strukturen und Räume schaffen, unterstützen und halten.
Ambidextrie (lat.: „ambo“/“dexter“ – „beide“ und „rechte Hand“ – also „Beidhändigkeit“) wird in Bezug auf Organisationen in der Bedeutung verwendet, zwei gegensätzliche Denk- und Vorgehensweisen gleichzeitig zu verfolgen. Robert Duncan, ein amerikanischer Organisationsentwickler und andere Wissenschaftler wie Michael Tushman, Charles A. O’Reilly und Julian Birkinshaw prägten diesen Begriff im organisationalen Zusammenhang. Gemeint ist damit die Fähigkeit, parallel sowohl die vorhandenen Handlungsweisen und funktional nützlichen Abläufe effizienter zu gestalten (Exploitation), als auch neue Themen, Innovation und Freiräume für Kreativität umzusetzen oder neue Geschäftsfelder zu erschließen (Exploration). Das kann also bedeuten, sowohl die bisherigen (hierarchischen, funktionalen, lange praktizierten) Routinen, Strukturen und Prozesse zu nutzen, um weiterhin effizient und effektiv zu sein. Und gleichzeitig in Netzwerken und Teams agil, flexibel und iterativ für Veränderungen und Innovationen proaktiv tätig zu sein. Oder in Teams ausgewählte agile Methoden zu nutzen, um moderner zu arbeiten. So können Verwaltungen das Standardgeschäft erledigen und schrittweise agiler werden.
BANI ist wie VUKA ein Akronym aus vier englischen Adjektiven, das die Welt als komplexe Gegenwart beschreibt: brüchig, ängstlich, nicht-linear und unbegreiflich (brittle, anxious, non-linear, incomprehensible). Der US-amerikanische Zukunftsforscher Jamais Cascio prägte dieses Akronym 2020. Brittle sind Dinge, die vermeintlich stark wirken, aber spröde, brüchig und verbraucht sind. Ängstlich ist in Bezug auf zu treffende Entscheidungen zu verstehen, die kaum richtig getroffen werden können oder die keine positiven Ergebnisse bringen. Nicht-linear beschreibt, dass Kausalitäten, also Wenn-Dann-Beziehungen oder Ursache und Wirkung nicht eindeutig herstellbar sind. Unbegreiflich seht für die Welt, die kaum noch zu fassen ist und in der Ereignisse oder Entscheidungen für uns nicht mehr nachvollziehbar sind. BANI richtet den Fokus also auf die Emotionen, die viele von uns haben. Wenn wir mit dem Blick auf BANI an unsere Herausforderungen heran gehen, können wir sie bewusster wahrnehmen. Und daraus Impulse ziehen, wie wir damit umgehen können, nämlich: belastbarer und flexibler werden, achtsamer und einfühlsamer in Bezug auf Ängste. Wir können Zusammenhänge herstellen und iterativ vorgehen. Letztlich können wir nicht Begreifbarem intuitiv und transparent begegnen anstatt rational und analytisch. In Verwaltungen können wir so mit einer resilienteren, flexibleren und agileren Haltung Herausforderungen standhalten. 🙂
VUKA bzw. VUCA ist ein (englisches) Akronym aus Volatilität (Volatility), Unsicherheit (Uncertainty), Komplexität (Complexity) und Ambiguität (Ambiguity). Die Abkürzung beschreibt die Herausforderungen unserer globalen Welt für Unternehmen und Organisationen – letztlich auch für uns alle. Beispiele: Aktienkurse unterliegen hohen, schnellen Schwankungen. Die Umwelt, Märkte und Bedingungen wie zum Beispiel die Zahl geflüchteter Menschen entwickeln sich sehr schnell und wir können nicht mehr sicher sein, dass die Welt morgen noch dieselbe ist – das bringt Unsicherheit. Die Krisen, Kriege und Umweltkatastrophen oder auch Social Media Posts haben Auswirkungen, die komplex sind, die wir nicht mehr absehen können, und für die wir schon gar keine Pläne entwickeln können, wie wir damit umgehen. Situationen, zum Beispiel in der Politik, in einer Stadtgesellschaft sind nicht mehr eindeutig, sondern viele verschiedene Interessengruppen bringen Ideen und Vorschläge ein, die gehört werden wollen. Wenn ihr tiefer einsteigen wollt: hier beschreibe ich die VUKA-Welt von Verwaltungen ausführlicher.
Teil 2 des Glossars von A – Z findest Du hier:
Folgende Quellen habe ich für alle Begriffe des gesamten Glossars auf folgenden Seiten gefunden: https://www.agileteams.de/studien/agiler-glossar/, https://www.projektmagazin.de/agile-methoden, https://mooncamp.com/de/blog/agile-methoden, https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/projektmanagement/agil/agile-methoden-ueberblick/, https://www.agiler-arbeiten.de/A-Z_Glossar_agiles_Arbeiten.html, https://fh-hwz.ch/news/was-bedeutet-bani, https://wirtschaftslexikon.gabler.de/


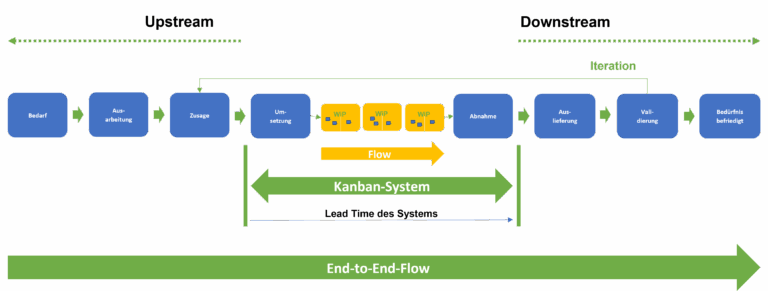
Toller Beitrag! Hast du das Agile Manifest schon auf Verwaltungsdeutsch gefunden? 🙂
Interessante Idee… 🙂 Meiner Meinung nach lassen sich die agilen Prinzipien eins zu eins auf die Verwaltung anwenden, da wären nur ein paar Wörter auszutauschen. Inspirationen findest Du hier: https://agile-verwaltung.org/wp-content/uploads/2016/11/20161121_fav_c3bcbersicht-agile-verwaltung_vl.pdf