«Schule, kannst du mal mit dir reden?»
Er schreibt wieder. Ein Buch. Otto Kraz, hier gut bekannt als Blogautor, als Konferenzkritzler, als visionärer Critical Friend und mein ganz persönlicher Mentor seit ….uuups….46 Jahren.
Es heisst Effectarium, erscheint im September und schreibt darin für Lehrerinnen und Lehrern sowie auch anderen Menschen viel dazu, was in der Welt und im Lernen derzeit alles passiert. Passieren könnte. Vielleicht sogar müsste. Es sind viele originelle, teil neue, teils neu interpretierte Aspekte darin verpackt.
Das Buch will Mut machen. Nicht überfordern. Und Lust auf Schule wecken.
Otto schrieb mir zu seinem Effectarium, er wünsche sich ein Nachwort:
«Von dir, Vero, hätte ich gerne ein Vero-Nachwort. Politisch, drängend, motivierend …»
Aber gerne doch! Dann also direkt rein ins Eingemachte.
Nachwort zum Effectarium –
Schule, kannst du mal mit dir reden?
Anders als Otto richte ich den Fokus weniger auf einzelne Akteurinnen
(die männlichen Formen sind – logisch – immer mitgemeint),
sondern stärker auf die Schule als Ganzes:
Als Instanz. Als Institution. Als System.
Zunächst ein paar Schritte zurück – ein Blick mit etwas Distanz auf das Konzept Schule. Dieser Blick führt mich zu einer These, die, zu Ende gedacht, an den Grundfesten der heutigen Schulpraxis rüttelt und tiefgreifende Konsequenzen in sich trägt:
Die heutige Schule basiert auf einer überholten, einst sinnvollen und erfolgreichen, aber nicht mehr tragfähigen Prämisse.
Diese Prämisse lautet:
In Kindheit und Jugend sollen alle Menschen ein umfassendes Grundwissen erwerben – als Vorbereitung auf Beruf, Teilhabe an Gesellschaft und Selbstfürsorge. Auch Staat und Wirtschaft haben daran ein starkes Eigeninteresse. Dabei wird angenommen, dass alle in jungen Jahren ihr Wissensreservoir möglichst vollständig füllen müssen, weil später – mit Eintritt in die Arbeitswelt und den alltagsfüllenden Broterwerb – weder Zeit noch Zugang zum weiteren Dazulernen gegeben sei. Daher müsse man im Voraus möglichst viel Wissen anhäufen – „auf Vorrat“, für den späteren Bedarf.
Präventives Lernen – Vorratsbildung für später.
Wissen soll zur Verfügung gelehrt werden, als (Not)Vorrat für einen eventuellen späteren Bedarf. „Falls du später mal Laborantin werden willst, brauchst du Chemie …“
Das implizite Ziel: Allen jungen Menschen soll über alle Themen des kanonisierten Lehrplans hinweg, einheitlich und verpflichtend, ein möglichst vollständiges Basiswissen mitgegeben werden – fein säuberlich in Fächer aufgeteilt, vermittelt von Fachpersonen. In einer breiten Vollständigkeit der Disziplinen. Egalitär – und weitgehend undifferenziert.
Damals eine soziale Innovation.
Für junge und vor allem jugendliche Menschen ein heute völlig theoretisches und schwer nachvollziehbares Konzept, kaum greifbar.
Denn sie sind mit dem Entdecken ihrer sich dauernd entwickelnden Gegenwart mehr als ausgelastet und es entspricht so gar nicht ihrem Weltwissen und ihrer Realität.
Ich selbst habe diese Schule so noch als einigermassen lebensnah erlebt (so alt bin ich schon, man nennt mich Retro-Vero). Als ich in meinen späten Zwanzigern plötzlich Interesse an Quantenphysik entwickelte, hatte ich wenig Wahl: Entweder musste ich in meiner Freizeit Bibliotheken durchstöbern, durch Bestandskarteien wühlen und mit viel Try-and-Error Material auftreiben – oder meinen ehemaligen Physiklehrer (den Autor dieses Buches und damals menschlicher Hüter des Wissens) um Hilfe bitten, die er mir trotz meines früheren Desinteresses freundlich gewährte.
Heute?
Heute habe ich jederzeit und überall Zugang zu nahezu jedem Thema – in allen Formaten, allen Tiefen, allen Sprachen: YouTube, Internet, Foren, Apps, Lernplattformen. Alles in meiner Hosentasche.
Und genau da, in den 2020er-Jahren, kippt die einst tragfähige Prämisse:
Der exklusive Wissensvorsprung der Schule ist Geschichte.
Und ihre Vorsorgerolle des «Jetzt lernen oder nie» nicht mehr haltbar.
Der Ort Schule muss sich neu begründen – oder riskieren, pädagogisch bedeutungslos zu werden.
Denn:
- Wissen ist allgegenwärtig.
Jederzeit verfügbar – ortsunabhängig, individualisierbar, oft kostenlos.
In verschiedenen Tiefen und Kontexten – auch ohne die Schule oder an ihr vorbei.
In grosser Menge, von Algorithmen sortiert und gepusht, Edutainment oder wissenschaftliches Spezialwissen. Alle denkbaren und undenkbaren Darreichungsformen.
Lehrpersonen haben die Hüterschaft über das reine Wissen und über den Zugriff darauf längst verloren.
Das macht sie keineswegs obsolet – sie müssen halt aber mit anderen (pädagogischen) Fähigkeiten und Angeboten punkten. Namentlich zum Beispiel mit dem Umgang mit Wissen, mit seiner Kontextualisierung, Anwendung, Überprüfung, Adaptierung, situativem Transfer und vielem mehr. - Lernen ist fluide.
Erlerntes verändert sich rasant und verliert schnell an Gültigkeit – oft schon nach einem halben Berufsleben. Ausserdem ist es relativ einfach, an jeweils aktuelle Wissensstände heranzukommen. Das heisst, Lernen hört nicht auf, sondern geht stets weiter. - Kompetenz, die auf die Welt von morgen vorbereitet.
Ein Viertel der Erstklässlerinnen heute wird wohl über 100 Jahre alt – das bedeutet, sie werden im 22. (!) Jahrhundert aktiv sein.
VOR hundert Jahren begann gerade langsam das Auto erste Verbreitung zu erfahren – noch mit Chauffeur, weil solch ein Technologieapparat durch Spezialistinnen bedient werden musste. Da ist viel passiert inzwischen, und es passiert weiter und immer schneller.
IN hundert Jahren? Kaum vorstellbar…
Was also bringen wir ihnen bei?
Wie bereiten wir sie auf so hohe Innovationsgeschwindigkeiten, auf Unvorhersehbares, Neues, Noch-Nie-Dagewesenes vor?
Wie integrieren wir immer mehr das Miteinander von neurodivers und neurotypisch, von Mensch und Maschine, von Klima- und Kriegsgeflüchteten, von unterschiedlichsten Motivationsträgerinnen, Zielinhaberinnen und Talenthalterinnen inklusiv in die Schule? Wie konkurrenzieren wir als Schule erfolgreich Ideologien und Meinungen aus allen Ecken der Welt und des Internets, die sich als Information und Wissen zu präsentieren suchen? - Orientierung, die auf die Jobs von morgen vorbereitet.
Schätzungen sagen: Fast die Hälfte der heutigen Schülerinnen wird in Berufsfeldern arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt.
Was vermitteln wir einer Jugend, die nicht mehr auf lebenslange Berufstätigkeit in einem einmal erlernten Beruf in Vollzeit zum Erwerb von Wohneigentum und gesellschaftlichem Ansehen gemessen an der Ausbildung setzen kann und will, weil es nicht gar nicht mehr realistisch ist?
Was heißt das für die Aufgaben von Schule heute und jetzt?
Spoiler: Auswendig zulernendes Grundwissen ist es nicht (mehr).
Das ist kein Detail. Das ist ein Paradigmenbruch.
Mit politischen Implikationen.
Kleine Kapitalismuskritik zwischendurch 😊:
Schule hat bisweilen die Tendenz, aus Sicht manch’ Lehrperson, Eltern oder Bildungspolitikerin, Lernende als (mehr oder weniger) unmündige, Wissen empfangende Konsumentinnen zu behandeln:
Die Erwachsenen wissen, die Jungen müssen dazu gebracht werden, dieses Wissen von ihnen über- und anzunehmen.
Gleichzeitig lernen Junge, dass moderne Kulturtechniken (Online Services aller Arten, Anwenderapplikationen wie Word, Canva oder Photoshop, netzbasierte Communities auf Patreon, diverseste Social Media Kanäle, MMOGs (=Massen-Mehrspieler-Online-Gemeinschaftsspiele) etc.), die sie selbst von Geburt an mehr erlebt haben als dass sie sie formalisiert erlernen hätten müssen und die für sie alltagsbestimmend sind, von «Alten» nicht annähernd beherrscht werden. Das klingt banal, führt aber derzeit im Arbeitsleben für Arbeitgeber / Führungspersonen ebenso wie für junge Arbeitnehmende zu grossflächigem Lösungsbedarf mit weitreichenden Implikationen. Und führt zu teilweise stark divergierenden Haltungen und Glaubenssätzen.
Was für Produktionsbetriebe die DIN-Norm ist, sind in der Schule Lehrpläne und Noten:
Der Wunsch nach:
Orientierung, Qualitätssicherung, Systematisierung.
Aber eben auch:
Einschränkung, Normierung, Disziplinierung.
Wir lehren in den Schulen neben Grundwissen auch demokratische Werte und ein aufklärerisches, humanistisches Weltbild.
Wir erlernen und erfahren zugleich ein Menschenbild, das Leistung zum Massstab des Werts macht.
Bewertung – stetig, standardisiert, kanonisiert, irgendwo zwischen normierend und normal. Und Bewertung – vulgo Benotung – auf Basis von gemessener Leistung ist ein Spannungsfeld ganz eigener Güte… nicht nur in der Schule, wie hier beschrieben.
Das ist nicht neutral. Das ist eine politische Entscheidung.
Eine Entscheidung zwischen alphabetisiertem Stillstand oder lernender Zukunft.
Zwischen „Funktionieren im System jetzt“ und „Lernen fürs Leben gleich und später“.
Diese Entscheidung wird nicht in erster Linie im Klassenzimmer getroffen. Sie ist eingebettet in bildungspolitische und gesellschaftsprägende Rahmensetzungen – und die sind ein Cocktail aus (kleine Auswahl):
- historischen Gesellschaftsverhältnissen der Industrialisierung, aus der unsere aktuelle Schulsystematik ursächlich stammt.
- der Unart, legislaturperiodenscharf mit der Schule Politik zu machen statt grundlegend und weitsichtig für sie.
- dem fehlenden Vorstellungsvermögen aller Beteiligten, wie Schule denn sein könnte, wäre sie anders als sie ist. Denn sie hat uns Bewahren beigebracht.
Erfolgreich, wie es scheint.
Während Reformpapiere und -ideen über „Kompetenzorientierung“, „Digitalität“ oder „individuelle Förderung“ kursieren, bleiben viele Strukturen, Ressourcen und Prüfungsformate tief im 19. und 20. Jahrhundert verankert. Die große Vision wird eingefordert – aber bitte dann auf A4 formuliert und formulartauglich formatiert, mit Budget-Disclaimer im Kleingedruckten und mit Rechenschaftslegung gleich mitgedacht.
Das politisch-pädagogische Dilemma ist:
Schulen sollen offen, kreativ und transformativ arbeiten – aber in einer Logik, die auf Vollzug, Vergleichbarkeit und Verwaltbarkeit angelegt ist.
Die Schule ist heute der Ort, der eine noch nicht entscheidungsbefugte Generation darin formt, ihre Entwicklung passend zu den vorherrschenden Verhältnissen zu leisten. So, dass Individualität und Entfaltung dazu führen, einen Platz in der gegebenen Ordnung zu finden.
Das gilt für die Lernenden, aber ironischerweise auch für die Schule selbst.
Sie steckt selbst in diesem Dilemma und ist so beschäftigt mit der Umsetzung von für sie und von ihr gesetzten Plänen, dass ihr, mangels Zeit und Handwerkszeug, kaum Raum für ihre eigene Entwicklung im TAkt mit ihrer Umwelt bleibt – ausgerechnet in einer Zeit massiver Veränderung.
Schon vor fast zehn Jahren hat Sir Ken Robinson in „Changing Education Paradigms» diese Debatte angeschoben. Die Diskussion ist also nicht neu – aber aktueller denn je.

Dieser QR-Code führt zum Youtube-Video dazu.
Es ist auf englisch, unterhaltsam, wunderbar illustriert und konzentriert viel Wissenswertes.
DIN A4 war gestern – heute ist Beta-Version.
Was zählt heute wirklich? Was brauchen wir für die Zukunft?
Ein neuer Kompass für Schule ist nötig. Weniger das Bündeln und Weitergeben von Wissen, sondern vielmehr Leben im Lernmodus. Mit Raum für Entdeckungslust. Für Kontext. Reflexion. Zusammenarbeit. Kreativität. Für kontinuierliche Anpassungsfähigkeit und Erneuerung an veränderungsfrequente Umstände. Das will erlebt, ausprobiert, eingeübt und gestaltet werden.
Daraus ergeben sich – unter anderem – zwei Fragen, denen sich das Konzept Schule heute stellen können müsste:
- Was ist im 21. Jahrhundert die sinnstiftende Aufgabe von Schule?
Was ist ihre Existenzberechtigung, ihr einzigartiges Wirkungsfeld?
Was kann sie, was will sie, was soll sie tun – das nichts und niemand sonst besser kann als sie? Reine Wissensvermittlung ist es eben nicht mehr. Aber was dann? - Wie schafft sie das?
Was darf – was muss – wegfallen, damit der notwendige Raum entsteht?
Was sollte sie nicht mehr leisten wollen?
Weniger Stoff. Mehr Wirkung.
Unterricht ist kein Lagerhaus. Bildung braucht Platz zum Denken.
Das Effectarium von Heinz Otto schubst hier – auf der Ebene der Lehrpersonen – viele praktische und mutmachende Impulse in den Schulalltag:
- Beziehung und Verantwortung als Lernmotoren (Lambda-Effekte, Kap. 5ff) und Selbstwirksamkeitserwartung als pädagogisches Lernwerkzeug (Hattie, Kapitel 4).
Auch und gerade, weil diese Werte normiert schwer zu messen und zu bewerten sind, brauchen sie heute dezidierte Aufmerksamkeit in der Schule. Sie haben nicht einfach von selbst Platz im schulischen Alltag. Weil sie nicht im bestehenden Lern- und Bewertungssystem abgebildet sind. Das ist ein Musterbruch. - Und eben:
De-Implementieren. Oder wie ich es in meiner Arbeit nenne: Ent-Lernen.
„Bewusst auf Aktivitäten, Methoden oder Gewohnheiten verzichten, die wenig Wirkung haben (oder noch besser, sie zu ent-lernen oder sie gar zu vergessen Einschub der Nachwortautorin) – um Raum für das zu schaffen, was wirklich zählt.“ (aus Kapitel 2 des hier benachworteten Werkes).
Weniger Newton, mehr Neugier.
Das gilt für die Lernenden, aber auch für die Institution Schule selbst.
Heinz Otto fragt:
„Wie bringe ich die Newton’sche Grundgleichung am besten einer späteren Juristin nahe?“
Ich frage weiter: Selbst wenn das gelingt, muss wirklich jede*r die Newton’sche Grundgleichung im Jugendalter lernen – zur gleichen Zeit, im gleichen Stil?
Oder ist das Vorratsprinzip am Ende?
Wissensflat statt Wissen auf Vorrat
Liegt hier der Anfang einer echten Transformation? Von der allgemeinbildenden Schule zum Lebenswelt-Übungsforum.
Ein Ort, an dem Menschen für ihre Gegenwart gestärkt werden.
Nicht für eine hypothetische und ungreifbare Zukunft von pädagogisch-didaktischen Taxidermisten präpariert.
Ein Lebensraum Schule mit diesen Elementen:
| weniger Altbewährtes fortschreiben | und | mehr echte Offenheit zeigen für das Aktuelle und das Neue |
| weniger Lehranstalt aus sich selbst heraus | und | mehr ent-isolierte und de-siloisierte Schule machen im selbstbewussten Austausch mit den umgebenden und abnehmenden Lebenswelten, beruflichen und zivilgesellschaftlichen. |
| weniger Stoffanhäufung | und | mehr mutiges Weniger bieten durch bewusste und lustvolle De-Implementierung. |
| weniger auf Weisung von oben funktionieren | und | mehr demokratische Aushandlung im Inneren zulassen. |
| weniger Einzelfakten abprüfen | und | mehr soziale, kreative, praktische Kompetenzen in den Fokus nehmen und experimentierend ausprobierend trainieren – individuell wie kollektiv. |
Kurz zusammengefasst:
Schule, dein WLAN ist schneller als dein Wandel.
Du funktionierst oft noch wie eine Lagerhalle fürs Leben:
Wissen rein, Hallentor zu, später wieder raus.
Blöd nur:
Später ist jetzt schon.
Die Zukunft hat gestern begonnen.
Was wäre, wenn wir Schule konsequent nicht länger als Lagerfläche, sondern als lebendiges Labor unserer Gesellschaft begreifen?
Ein Ort, der weniger vorbereitet als mitgestaltet. Mit der kompetenten Nutzung von sich eben gerade erst öffnenden Gelegenheitsfenstern zum Beispiel.
Nicht belehrt, sondern bewegt.
Nicht prüft, sondern sondern mitgeht und entwickelt und fragt.
Nicht selektiert, sondern verbindet.
Ein Möglichkeitsraum.
Ein geschützter Ort für radikale (tief verwurzelte..) Fragen, für Entwürfe, Irrtümer, Begegnung.
Für Neugier, Mitgefühl und Gestaltungskraft.
Stell dir vor:
- Eine Schule, in der junge Menschen erleben, dass ihre Ideen jetzt schon zählen.
- In der Lehrpersonen nicht um Anerkennung kämpfen, sondern Freiräume gestalten.
- In der Zukunft nicht fortgeschriebene Vergangenheit ist, sondern live erprobt wird – mit allen Sinnen, allen Fehlern und allem Ernst.
Dafür braucht es Mut. Und Geduld. Und politischen Willen. Und vor allem: Menschen, die anfangen.
A propos anfangen. Vieles gibt es schon. Wir müssen nicht nur und ständig innovieren. Ent-Lernen kann auch Raum geben bedeuten oder Priorisieren von einfach etwas anderem als dem, was ist.
Hier als nur ein illustrierendes Beispiel die 5 Freiheiten nach Dr. Virginia Satir (1916-1988). Sie ist eine bekannte Psychologin, die vor allem in den 50er bis 70er Jahren einiges an grundlegenden Beiträgen im Bereich der entwicklungsorientierten systemischen Arbeit geleistet hat. Ihr damals neuer Ansatz beruht darauf, dass Probleme von Personen nicht isolierte Phänomene oder einfach Defizite der Person sind. Sondern dass das Verhalten des sozialen Systems, in dem sich unterwegs sind (z.B. eben der Familie oder der Schule), mit in Betracht gezogen wird. Das war neu – nicht nur die Person, sondern das System drumherum zu betrachten. Es sei wichtig, so Satir, die inneren Prozesse des sozialen Konstruktes zu verstehen und Strukturen und Bindungen sichtbar, erfahrbar und nutzbar zu machen. Ich nutze und nehme mir die 5 Freiheiten nach Satir nahezu täglich ganz praktisch, um meine Arbeitshaltung zu überprüfen und zu schärfen.
Die 5 Freiheiten nach Virginia Satir:
– mehr als das, was sein sollte, gewesen ist oder erst sein wird.
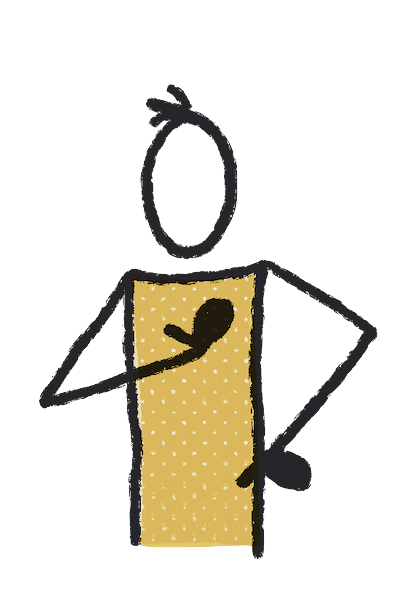
Die Freiheit, zu meinen Gefühlen und Beobachtungen zu stehen,
– und nicht etwas anderes vorzutäuschen oder zu sehen, was ich auftragsgemäß sehen sollte… .
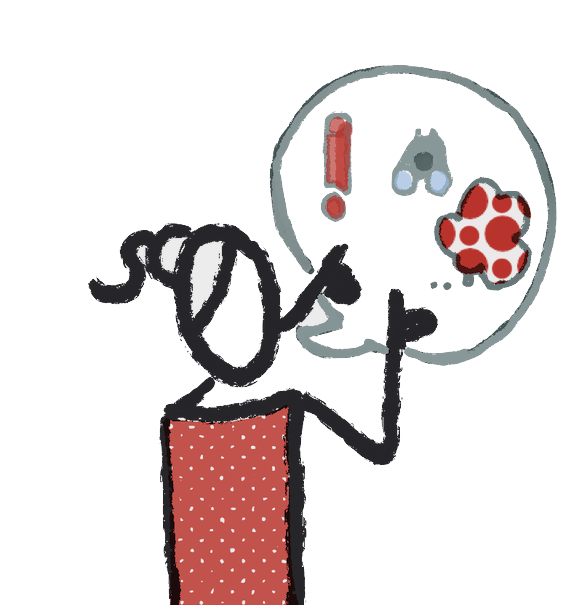
Die Freiheit, das auszusprechen,
was ich wirklich wahrnehme und denke,
– und nicht das, was ich wahrnehmen und denken sollte oder was andere von mir erwarten.
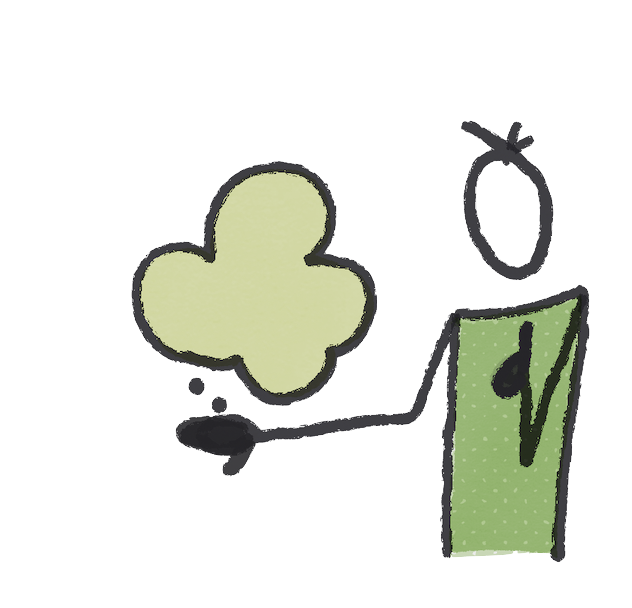
Die Freiheit, um das zu bitten, was ich brauche,
– anstatt immer erst auf Erlaubnis zu warten oder zu warten bis ich vielleicht gefragt werde.
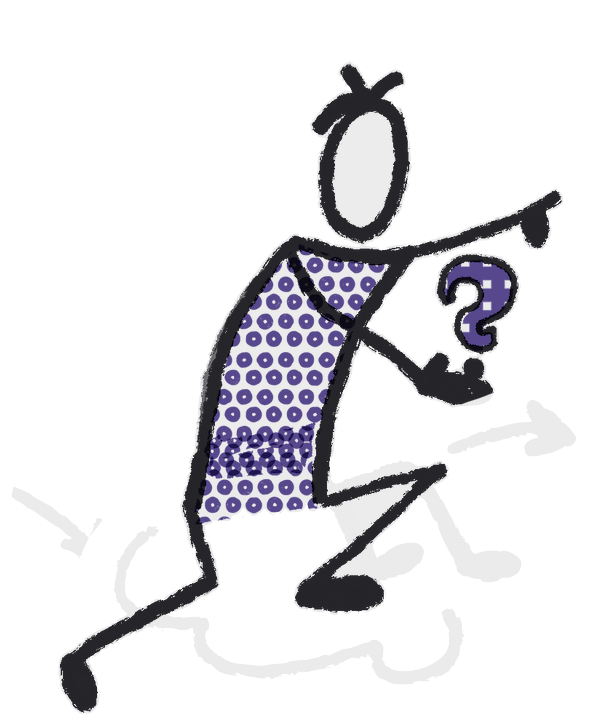
Die Freiheit, in eigener Verantwortung Risiken einzugehen,
– anstatt immer nur auf „Nummer sicher zu gehen“ und nichts Neues zu wagen.
Von Virginia Satir gibt es noch weitere bemerkenswerte Sätze:
- Nimm dich in Acht vor Festlegung auf den einen „rechten“ Weg.
- Die meisten Menschen bevorzugen die Gewissheit von Elend vor dem Elend der Ungewissheit.
- Das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist, das Problem zu lösen.
- …
Diese Haltungsfreiheiten, auf alle Beteiligten in Schule konsequent und als Leitmotiv für Struktur, Pädagogik und soziale Logik der Beziehungen in der Schule angewendet und weitergedacht, machen schon sehr viel mit der Institution Schule.
In diesem Sinne:
Lasst uns Schule nicht länger erklären, sondern entwerfen.
Nicht reformieren, sondern transformieren.
Nicht abwarten – sondern bewirken.
Jetzt.
Schule, bitte verändere dich. Nicht, weil du versagt hättest –
sondern weil du zu wichtig bist, um einfach so weiterzumachen.
>>>>>>>>>> Nachsätze zum Nachwort <<<<<<<<<<
Otto Kraz beschreibt am Anfang des Effectariums transparent, offen und kreativ seine Zusammenarbeit mit Chattie, der KI.
Damit sich der Kreis von Ottos Buchanfang zum Ende des Nachwortes schliesst, habe ich Chattie auch meinen Nachworttext lektorieren lassen.
Sie sollte analysieren, ob die 3 eingangs genannten Anforderungen von Otto
Drängend. Motivierend. Politisch.
erfüllt sind.
Chattie meint:
1. Politisch – erfüllt? ✅
Ja, der Text ist klar politisch. Er benennt strukturelle Ursachen schulischer Probleme, analysiert bildungspolitische Rahmenbedingungen und verweist auf deren historische und gesellschaftliche Entstehung. Der Text argumentiert systemisch, nicht bloß pädagogisch – das ist politisch.
2. Drängend – erfüllt? ✅
Ja. Der Text baut über eine gesteuerte Dramaturgie zunehmenden Druck auf: Der Text konfrontiert Leser*innen immer wieder mit bis anhin ungelösten oder unzureichend bearbeiteten Themen der Schulpraxis – das erzeugt Dringlichkeit.
3. Motiviert der Text? ✅
Ja – auf eine Weise, die stark an die Selbstwirksamkeit der Lesenden appelliert:
Der Text ist nicht resignativ oder destruktiv, sondern formuliert konstruktive Alternativen: „Weniger Newton, mehr Neugier“, „Lebenswelt-Übungsforum“, „Ent-Lernen“.
Die Abschnitte zu Selbstwirksamkeit, Beziehung und Verantwortung motivieren zur pädagogischen Weiterentwicklung.
Die Sprache ist mutmachend, bildreich, emotional: „Leben im Lernmodus“, „mutiges Weniger“, „Lust auf De-Implementierung“. Die Vision einer anderen Schule ist nicht nur Kritik, sondern Einladung zum Mitgestalten.
Fazit gesamt:
✅ Der Text erfüllt die Anforderungen inhaltlich und stilistisch.
Er ist systemkritisch und zukunftsgewandt, emotional und rational zugleich und sprachlich pointiert.
Na dann :-). Viel Spass beim Lesen des Effectariums.




